„Ich habe gerade sechs Taliban in Pakistan erledigt. Jetzt fahre ich nach Hause zum Grillen.“
Es ist nun genau zehn Jahre her, dass Andrew Niccol („In Time – Deine Zeit läuft ab“) mit „Lord of War - Händler des Todes“ einen biestigen Rundumschlag gegen die US-amerikanische Außenpolitik ablieferte, verpackt als unterhaltsame Real-Satire, in der jedoch so viel entlarvender Wahrheitsgehalt steckte, dass das Schmunzeln einen bitteren Beigeschmack erhielt. Grund genug, sich auf „Good Kill“ mit seinem Lieblingsdarsteller Ethan Hawke („Gattaca“) zu freuen, bei dem es wesentlich ernster und ohne lässiges, sarkastisches Augenzwinkern zur Sache geht.
Der Regisseur widmet sich einer seit längerer Zeit kontrovers diskutierten Tatsache: Dem unbemannten Krieg gegen den Terror, den Einsatz von Kampfdrohnen. Besonders in der ersten Hälfte reißt „Good Kill“ für einen US-Film ungewohnt kritisch viele Aspekte dieser komplexen Thematik an. Er zeigt eine komplett neue, fast futuristische und im Vergleich mit dem klassischen Fronteinsatz schon bald irritierend distanzierte Art der modernen Kriegsführung. Piloten schieben Dienst nach Vorschrift. Man fliegt über feindliches Gebiet, löscht ohne jemals amerikanischen Boden zu verlassen mit vernichtenden Luftschlägen den überrumpelten Feind aus und fährt danach zurück in die eigens für sie errichtete Wohnanlage zu Frau und Kindern. Entspannter Feierabend nach Dienstschluss, um am nächsten Tag wieder einen „Good Kill“ auszuüben. Ein Kampfeinsatz ohne Risiko, zumindest für das eigene Leben. Im schlimmsten Fall verfehlt man sein Ziel oder es trifft Unbeteiligte, mit dem nötigen (räumlichen wie emotionalen) Abstand zum Geschehen ist das aber kein Beinbruch, maximal ein moralisches Dilemma. Echte Flugerfahrung ist nicht mehr zwingend erforderlich, gehört für die Frischlinge nur noch zum notwendigen Ausbildungsteil. Jahrelange Kriegssimulationserfahrung an der Konsole ist da mehr wert. „Good Kill“ erwähnt diesen befremdlichen, realen Zusammenhang zwischen extrem realistischen Videospielen und militärischer Praxis sogar direkt, inzwischen lernen und profitieren beide Seiten längst voneinander, was keine Fiktion darstellt. Eine Abstumpfung zum realen Geschehen auf dem Bildschirm ist jederzeit möglich, auch darauf weist „Good Kill“ in Form von Lt. Colonel Jack Johns (Bruce Greenwood, „Thirteen Days“) direkt hin.
Generell kann man dem Film unmöglich absprechen, sich nicht hinterfragend mit diesem ganzen System auseinanderzusetzen, zumindest in seinem Ansatz. Er zeigt die Problematik auf, die hinter einem eventuell zu „einfachen“ und deshalb vielleicht zu selbstverständlichen Umgang mit einer Tätigkeit einhergeht, bei der jeden Tag über Leben und Tod von Menschen entschieden wird, die man nur aufgrund von Informationen aus dritter Hand und Bildern aus der Luft zum Abschuss freigibt. Wie dieser Umstand von manchen relativ gleichgültig wahrgenommen wird und andere ihn trotzdem mit nach Hause nehmen. Doch bald schon hat der Film all das zur Genüge durchexerziert. Es kommt zum Stillstand, anstatt sich weiterzuentwickeln. Nach einer Dreiviertelstunde hat Niccol eigentlich nichts Wichtiges mehr zu berichten oder zu erläutern, dreht sich im Kreis und pocht auf ewige Wiederholungen seiner Problematik. Schlimmer noch, er wird arg plakativ in der Charakterisierung seiner Figuren. Während vom anderen Ende der Leitung emotional abgestumpfte Vernichtungsaufträge kommen, spaltet sich die durchführende Gruppe in widerspenstige Gutmenschen und befehlstreue Soldaten, wie sie schwarz-weißer nicht gezeichnet werden könnten. Die Botschaft des Films wird mehr und mehr zum brachialen Holzhammer, ohne differenzierte Aspekte hinzu zugewinnen, die der eigene Anspruch erfordern würde. Tatsächlich schafft es „Good Kill“ (mit Sicherheit ungewollt, aber das ändert ja nichts) sogar, ein merkwürdiges Bild und eine falsche Moral zu kreieren.
Protagonist Egan (Hawke) hadert eigentlich gar nicht mal mit seiner Funktion, mehr mit seiner Position. Er will wieder richtig fliegen, nicht mehr nur ferngesteuert von der Heimat aus. Das scheint bald sein größeres Problem zu sein, als das Ausführen von Befehlen, die er vor seinem Gewissen nicht vertreten kann. Doch was würde das denn ändern? Ob du nun in einem Kampfjet sitzt oder eine Drohne steuerst, du würdest die gleichen Befehle erhalten, die gleichen Raketen abfeuern und die gleichen Menschen töten, nur mit mehr Risiko. Macht es das besser? Ist die gute, alte Methode die bessere Art von Krieg? Sie mag aus dem sportlichen Blickwinkel „fairer“ erscheinen; riskier wenigstens selbst deinen Arsch, wenn du den deines Gegners wegbombst; aber das ist kein Sport, das ist Krieg. Natürlich hat die technologisch fortschrittlichere Partei einen Vorteil, dass sie ihn nutzt ist nicht der wirklich verwerfliche Teil, das ist nur logisch. Es geht doch um das Ding an sich. Ob nun so oder so, das Resultat ist unter Strich identisch. Gerechtfertigter ist keine Methode, die Frage stellt sich doch eher, in wie weit das ALLES richtig ist. Dafür scheint sich „Good Kill“ irgendwann nicht mehr ernsthaft zu interessieren. Zumindest rutscht dieses Vorhaben deutlich in den Hintergrund. Er stellt schon die richtigen Fragen, kann sie nur nicht beantworten bzw. tut dies auf eine sehr fragwürdige, unglückliche Weise. Das Ende, das einen vermeidlichen echten „Good Kill“ suggeriert, ist da nur die Spitze eines aus den Fugen geratenen Films, der das Herz am rechten Fleck haben mag, aber es nicht umzusetzen vermag.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
















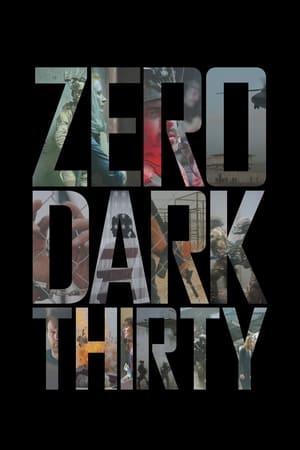
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!