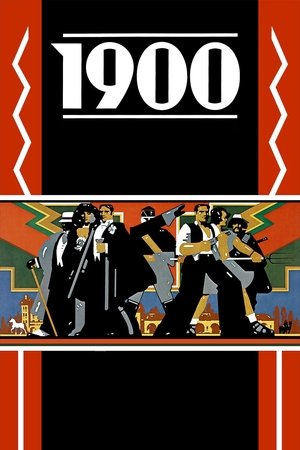Filme, deren Hauptdarsteller durch tragische Umstände die eigene Premiere nicht mehr erlebten, umgibt immer ein besonderer Mythos. 1994 genoss The Crow – Die Krähe viel größere Aufmerksamkeit, als es vermutlich ohne den durch beim Dreh bis heute auf fragwürdige Weise eingetretenen Tod von Brandon Lee stattgefunden hätte. Und 2008 wurde The Dark Knight schon vor dem ohnehin heiß erwarteten Kinostart zu einem einzigen Requiem, da die bis dato vielleicht nicht zwingend beste, aber sicherlich spektakulärste Rolle von Heath Ledger gleichzeitig seine letzte werden sollte. Auch Giganten wird diese undankbare, gleichzeitig aus Sicht von Marketing und filmhistorischer Relevanz auf makabre Art „unbezahlbare“ Ehre zuteil. Der gerade mal 24jährigen Shootingstar James Dean (Jenseits von Eden) durfte seine dritte und größte Kinoarbeit (Statisten-Auftritte nicht mitgezählt) nicht mehr selbst in Gänze begutachten. Am 30. September 1955 verunglückte er bei einem Verkehrsunfall. Und was tat Warner Brothers? Verschob den Kinostart doch tatsächlich auf seinen ersten Todestag, nachdem sein Ableben und der posthum Ruhm von …denn sie wissen nicht, was sie tun ihn zum Idol einer ganzen Generation machte. Irgendwo clever, irgendwie pervers.
Aufgrund dessen womöglich verflucht musste der Film trotz extrem gutem Kritiker- und Publikumsfeedback und stattlichen 10 Nominierungen als großer Verlierer der Oscarverleihung 1957 betrachtet werden, als ihm das Gute-Laune-Abenteuer In 80 Tagen um die Welt den Rang ablief und lediglich George Stevens (Das Tagebuch der Anne Frank) für sein Mammutprojekt als bester Regisseur ausgezeichnet wurde. Vielleicht war es aber auch nicht der Film, mit dem sich Hollywood damals über Gebühr brüsten wollte. Schließlich greift er hinter seiner so geliebten Fassaden vom großen Traumfabrik-Kino, vom epischen Südstaatendrama über die Grundpfeiler des amerikanischen Selbstverständnisses ungewohnt reumütige Töne auf und schleudert diese in fast 200 Minuten immer wieder sehr direkt in Richtung eines Publikums, das derart selbstreflektierte Kritik nicht unbedingt flächendeckend hören wollte…oder sollte.
Denn Giganten ist ein Film, der so eigentlich nur aus den USA kommen kann. Der alles aufgreift und verwendet, was dieses Land so liebt und für sich selbst in Beschlag nimmt. Seine epischen Ausmaße, seine Tradition und Geschichte, sein immer mal wieder wahrwerdendes Märchen vom einst tellerwaschenden Millionär und ein bald erschlagendes Selbstbewusstsein, wenn es um das Aufzeigen seiner Schönheit und Strebsamkeit geht. Fast ketzerisch – in den frühen 50er, als die Romanvorlage von Edna Ferber entstand und auch noch zur Uraufführung des Films – mutet es an, wenn stolzer Traditionalismus, gesellschaftliche Gepflogenheiten in speziellen Regionen und selbstverständliches Klassendenken (was nichts anderes ist als blanker Rassismus ohne jegliches Unrechtsbewusstsein) öffentlich zur Schau gestellt und in all seiner Hässlichkeit entlarvt wird. Zudem noch in erster Linie von einer selbstbewussten, damals eher als vorlaut wahrgenommenen Frau namens Leslie (Elizabeth Taylor, Wer hat Angst vor Virginia Woolf?) aus dem liberaleren, „verweichlichten“ Osten, die hier in Texas bei ihrem mit der Zeit immer gröberen Märchenprinzen „Bick“ Benedict (Rock Hudson, Fremde Bettgesellen) sich eigentlich wie das liebe Vieh in die Herde einzureihen hat. Ihren Platz kennen sollte und nicht aus der Reihe tanzt oder gar den Schnabel aufmacht, wenn die Herrenrasse- oder Runde gerade wichtig Dinge zu diskutieren hat.
Trotz dieser offensichtlichen Schieflage von Grundprinzipien und der Interpretation der jeweiligen Rollenmuster wirft sich die kesse Leslie nicht gleich dem knackigen, leicht aufmüpfigen Arbeiter Jet (Dean) an den Hals, obwohl der sein Interesse nur sehr geringfügig verbirgt und es in jedem zweitklassigen Groschenroman exakt so ablaufen würde. Leslie bleibt mühelos standhaft, denn egal wie sehr sie ihr Bick auf gewisse Weise ernüchtert oder gar bitterlich enttäuscht, sie liebt diesen Mann aufrichtig. Obwohl er ein echter, texanischer Großgrund-Sonnenkönig per Geburtsrecht ist, der diese Rolle mit der Muttermilch aufgesogen hat und nichts anderes kennt als sein selbstgerechtes, dominantes und teilweise menschenverachtendes Weltbild. Mit zunehmender Laufzeit – und davon ist reichlich vorhanden – wird deutlich, dass Giganten nicht den Zeigefinger auf einzelne Figuren richtet und diese für ihr Tun exklusiv anprangert. Ganz im Gegenteil, speziell für seine ambivalenten Hauptfiguren findet er immer wieder verständnisvolle, leicht versöhnliche Erklärungen, nicht zu verwechseln mit universellen, von jeglicher Verantwortung befreienden Entschuldigungen.
Es ist mehr der Gesamtzustand eines sich stetig und rasend schnell entwickelnden Landes, in dem das Eine seinerzeit völlig normal und legitimiert ist, nun plötzlich vom notwendigen und richtigen Fortschritt nicht nur komplett überholt, sondern sogar konsequent zersetzt wird. Diese Traditionen und Werte sind oft nicht mehr als antiquierte, noch aus der nie so wahrgenommenen, barbarischen Vergangenheit resultierend, auf der die USA ihren American Dream tatsächlich erst kurz zuvor begründeten. Texas ist gestohlener Boden von denen, die nun dort ein Sklavendasein fristen. Was darunter brodelt ist wertvoller als das was ihn bewohnt. Und auch wenn man sich als kleiner Mann aus dem Schatten des Giganten erhebt und ihn nach Jahrzehnten selbst in den Schatten gestellt hat, es bleibt die bittere Erkenntnis, dass sich mit Geld nicht alles kaufen lässt. Liebe, Glück, Geborgenheit. Die obszöne Dekadenz und die schützende Selbstherrlichkeit: Vorgetragen von Einzelnen, stellvertretend für eine ganze Nation. Wo sich gebürtige Amerikaner mit Migrationshintergrund erst als solche fühlen dürfen, wenn der nächste Krieg ihre Loyalität verlangt, aber ein Platz beim Friseur oder im schäbigsten Diner nicht mit dem Nationalstolz zu vereinbaren ist.
In auslabendem Gigantismus, wie es sich beim dem Titel gehört, walzt Giganten durch die Geschichte eines Landes, dargeboten aus der Sicht eines sich langsam auflösenden Familienclans. Weil sie beginnen, sich von einst vielleicht sinnvollen, aber am Puls der Zeit nur blockierenden und stagnierenden Bindungen zu trennen. Eine Familie zerfällt nicht, sie schlägt nur anderweitig Triebe, was die Existenz langfristig sichert. Und, natürlich, erkennt dies nach einer langen Reise auch das Oberhaupt in einem besonders für ihn schwierigen Prozess irgendwann an, was der Film mit seinem selbstverständlich ebenfalls gepflegten Pathos hier und da am Ende gerne auch zu dick aufträgt. Das Finale ersäuft bald an oberflächlicher In-Your-Face-Selbstbeweihräucherung, damit auch bloß niemand die Message nicht aufsaugen könnte. Aber womöglich war das 1956 ernsthaft noch notwendig und appelliert letztlich an das Richtige. Bedenkt man, wie wenig sich in den USA in gewissen Punkten seitdem getan hat und wo sich in der jüngsten Vergangenheit gar zurückbewegt wurde, scheint dies sogar heute noch nötig zu sein. Besonders jetzt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org