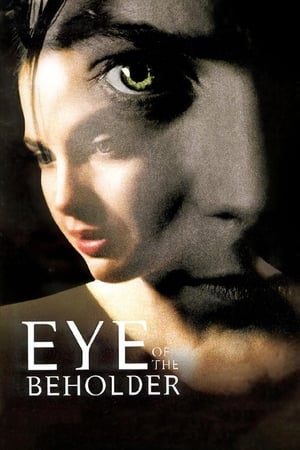Erwähnungen
Eye on Juliet
Eye on Juliet - Im Auge der Drohne (2017)

- 90 Min Drama
- Regie
- Drehbuch
- Cast Alexia Fast
Inhalt
Seit der Trennung von seiner Freundin befindet sich Gordon in einer emotionalen Krise. Ablenkung findet er nur bei seiner Arbeit. In einer Hightech-Sicherheitsfirma überwacht er von Detroit aus mit Hilfe von Drohnen eine Ölpipeline in Nord Afrika. Eines Tages schnappt er dabei zufällig die Unterhaltung eines jungen Pärchens auf, das aus dem Land fliehen will, da der Frau eine Zwangsehe mit einem anderen droht. Gegen alle Vorschriften beschließt Gordon ihr zu helfen.
Kritik
Die Drohnentechnologie hat längst schon Einzug in unseren Alltag gefunden, wirkt nicht mehr wie ein futuristisches Werkzeug das nur staatlichen und speziell militärischen Zwecken dient. Dabei birgt der Fortschrift neben allerhand von Vorteilen und Erleichterungen natürlich genauso viele Gefahren, und wir befinden uns noch längst nicht am Ende der Fahnenstange der Entwicklung und Nutzung. Somit unweigerlich auch ein im aktuellen Zeitgeschehen besonders relevantes wie spannendes, vielfältig verwendbares Thema für filmische Stoffe, was in den letzten Jahren nicht rasant, aber deutlich spürbar zunimmt. Mit Eye on Juliet – Im Auge der Drohne erzählt der kanadische Independent-Regisseur- und Autor Kim Nguyen (Rebelle) von zwei völlig verschiedenen Welten, die durch das Auge eines Drohne miteinander verbunden werden und dem Schicksal zweier Menschen, das dadruch entscheidend beeinflusst wird.
Gordon (Joe Cole, Peaky Blinders) trauert in Detroit immer noch seiner Verflossenen hinterher, während Ayusha (Lina El Arabi, Die Hochzeit) in einem nicht näher genannten, nordafrikanischen Land ihre große Liebe zwar gefunden hat, diese aber nicht ausleben darf. Denn die junge Frau steht kurz vor der elterlich eingefädelten Zwangsehe mit einem wesentlich älteren, ihr fast völlig fremden Mann, was sie und ihren Liebhaber nur die Option lässt, eine kostspielige und riskante Flucht nach Europa anzustreben. Gordon erfährt davon zufällig während seiner Arbeit. Dort schiebt er die Nachtschicht in einer globalen Sicherheitsfirma, die mit Drohnen die tausende Meilen entfernte Ölpipeline auf dem fremden Kontinent über- und bewacht. Obwohl er im Beruf mit allerhand hochmodernen Technik-Gedöns zu tun hat, ist Gordon eigentlich der eher konservative, häusliche Typ. Der noch nie sein Heimatland verlassen hat und den Rest der Welt nur über den Bildschirm seines Computers kennt, nüchtern-distanziert und fast emotionslos seine Aufgabe erfüllend.
Besonders spannend ist der Job auch nicht. Ab und zu ein paar Öl-Diebe mittels Warnschüssen aus den Roboter-Spinnen einen Schreck einjagen, wenn höfliche Aufforderungen nicht ihren Zweck erfüllen stellt schon das seltene Highlight dieser monotonen Tätigkeit dar. Als seine Mikrofone zufällig Fetzen einer Unterhaltung aufschnappen und er sich auf den ersten Blick in die ihm unbekannte Ayusha insgeheim verliebt, vernachlässigt er relativ schnell seine Aufgabe. Als er von deren tragischen Geschichte erfährt, setzt er alle Hebel in Bewegung um ihr mit der ihm verfügbare Technik beizustehen. Damit riskiert er, obwohl er praktisch nur am anderen Ende der Welt auf einen Bildschirm starrt, selbst Kopf und Kragen, zumindest beruflich. Für Ayusha geht es indes um die vielleicht letzte Chance auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Die Idee ist interessant und beinhaltet nicht nur aufgrund ihrer Aktualität gewisse ethische und moralisch Fragen, die der Film allerdings nicht großartig zur Diskussion stellt und zudem auch noch ungewollt ein ziemlich befremdliches Verhalten seines Protagonisten als romantisch, ritterlich und selbstlos verharmlost.
Was passiert denn hier genau? Ein einsamer, sich aus dem Sozialleben immer mehr abkapselnder und inzwischen schon als mindestens depressionsgefährden einzustufender Mann überwacht mit hochentwickelten Drohnen eine völlig ahnungslose Frau. Verfolgt sie bis nach Hause, belauscht und spioniert sie aus. Dabei kennt er sie gar nicht, hat sie vor wenigen Tagen das erste Mal durch einen Kamera kurz gesehen. Das ist ihm so wichtig, dass er seinen eigentlich Arbeit außen vorlässt, sogar das Material seiner Auftraggeber missbraucht und, damit das Ganze nicht auffliegt, betäubt er noch Nacht für Nacht seinen eigentlich befreundeten Kollegen. So was nennt sich wiederholte, gefährliche Körperverletzung, aber was soll’s? Und der Rest im übrigen Stalking, mal ganz nebenbei. Sogar ein Bild der Angebeteten schmückt inzwischen seine Wohnung, wie sich das für jemanden wie ihn in der Situation offenbar gehört. Wäre das der Auftakt eines Psychothrillers, der die Gefahren der modernen Technik kritisch aufzeigen und hinterfragen soll, alles klar. Aber ist es nicht.
Das soll tatsächlich als aufopferungsvoll romantischer Akt der Nächstenliebe verstanden werden. Schließlich schreitet er seiner observierten Geliebten irgendwann auch sehr aktiv zur Hilfe, was diese dankend annimmt. Schön und gut, aber mal angenommen – und das wäre durchaus legitim – was wäre denn, wenn sich die Frau durch dieses sonderbare Verhalten eines durch einen bewaffneten Roboters personifizierten Fremden, der sie zunächst heimlich ausspioniert hat und offenkundig beinah (?) besessen von ihr ist, statt beschützt ernsthaft bedroht fühlen würde? Das würde das Szenario in ein völlig anderes Licht rücken und ehrlich gesagt ist man als Zuschauer sich auch nicht sicher, wie denn „unser Held“ reagieren würde, wenn das ihre Reaktion wäre. Diesen Gedanken hat sich Kim Nguyen offenbar nie gemacht und erzählt seine Geschichte so selbstverständlich aus der Liebe-auf-Distanz-Warte auf ein zudem übertrieben kitschiges Finale hin, dass sie jedem Realitätsbezug - oder wenigstens dem Bewusstsein dafür, das dem so sein könnte - absolut spottet. Das ist nicht nur ungeschickt, das ist ehrlich gesagt schon fast dämlich und enorm am möglich reizvollen Thema vorbei.
Fazit
Wenn heimliche Nachsteller zu Märchenprinzen werden. Sicherlich ungewollt (was hier noch schuldmindernd angerechnet wird), deshalb aber nicht weniger verharmlosend wird bedenkliches Verhalten glorifiziert und im Rahmen seiner verkitschten Handlung letztlich als Akt der maximalen Selbstlosigkeit und Menschlichkeit dargestellt…obwohl er am Ende ja doch bekommt, was er will. Nur ohne Gewaltanwendung, ganz freiwillig. Die Anleitung für erfolgreiche Stalker, nur leider ist dafür eine Multimillionen-Dollar-Ausrüstung nötig. Schade, aber dann könnte das ja jeder.
Kritik: Jacko Kunze
Es liegen noch keinerlei Meinungen und Kritiken für diesen Film vor. Sei der Erste und schreib deine Meinung zu Eye on Juliet - Im Auge der Drohne auf. Jetzt deine Kritik verfassen
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...