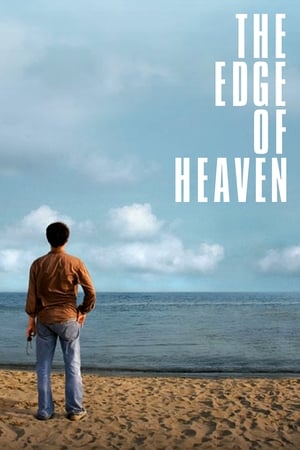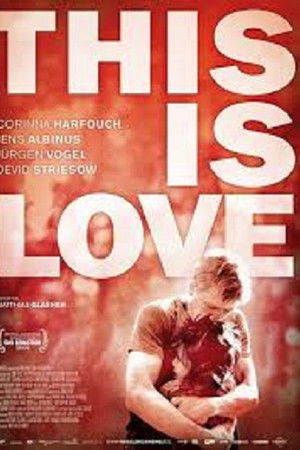Der deutsche Regisseur Christian Zübert hat sich über die Jahre durchaus einen Namen gemacht. Sei es mit der netten Komödie „Hardcover“ mit Wotan Wilke Möhring oder aber mit dem Publikumsrenner „Lammbock“, den er Anfang der 2000er mit Moritz Bleibtreu verwirklichte. Mittlerweile hat sich das Interesse von Zübert jedoch in eine andere Richtung leiten lassen, sodass eine Abkehr von der Komödie auf dem Programm stand. Mit „Ein Atem“ hat der Filmemacher nun eine pure Tragödie abgeliefert, in der nur ein einziges Mal so etwas wie Humor aufblitzt. Der Film war auf mehreren internationalen Festivals überaus erfolgreich, bekam in amerikanischen Fachpressen positive Stimmen und wird nun Ende Januar auf Erfolg an den deutschen Kinokassen hoffen. Zu wünschen wäre es.
Mit dem Atem beginnt das erste Kapitel, ein Atem der Leidenschaft und der Lust ist es. Eine Lust, die jedoch relativ schnell verfliegt und durch das Eindringen anderer Menschen zurückgedrängt wird. Elena und ihr Freund sind glücklich miteinander, aber nicht mit ihrem Leben in Griechenland, weshalb Elena (intensiv nah: Chara Mata Giannatou) beschließt, in Deutschland auf Jobsuche zu gehen. Ein Atem, aber zwei Gesichter, wenn sie in den Fernbus steigt, auf dem Weg nach Deutschland, und ihr Gesicht im Fenster reflektiert. Sie fährt weg aus ihrer Heimat, zu der sie jedoch keine Verbindung zu haben scheint. Die Stadt bleibt anonym. Verborgen, entweder in der Dunkelheit oder in der Unschärfe. Zunächst findet die Griechin schnell Arbeit, wird aber einmal mehr durch das Eindringen eines dritten Menschen an ihrem unmittelbaren Bedürfnis gehindert. Es ist ein stetiges Hinundher in Elenas Leben, eine Art tragischer Tanz, der aus einem Schritt nach vorn und zwei Schritten zurück besteht. Ihr Name ist wohl nicht zufällig sehr nah an dem Wort Elend.
Wenn Elena schließlich auf Tessa (Jördis Triebel „Blochin - Die Lebenden und die Toten“) trifft und beschließt, als Babysitter auf die kleine Lotte aufzupassen, dann wirkt das zunächst so, als würden hier zwei Welten aufeinander treffen. Ein Trugschluss, den Zübert noch durchdekliniert und am Ende als solchen mit aller depressiven Kraft entlarvt. Zwei Welten, die eine wohlhabend aus der Oberschicht, die andere ohne Kontakte, ohne Freiheiten und auch ein Stück weit unterdrückt. Der deutsche Regisseur entfaltet seine Geschichte sehr gemächlich, verliert dabei jedoch nie die nötige Konsequenz und hat ein Gespür für vielschichtiges Drama, wobei er äußere und innere Tragik gekonnt trennt, addiert und ineinanderwürfelt. Dabei helfen die realen Darbietungen seiner beiden Hauptdarstellerinnen immens. So entwickelt sich die Geschichte immer weiter, ist gnadenlos und herzzerreißend, vor allem aber wohl der reinste Horrorfilm für Eltern und alle, die schon einmal die Verantwortung für ein Kind übernommen haben. Ganz groß, verkauft sich aber nie so und schafft es ganz ohne Musik und technischem Firlefanz den Puls in die Höhe und den Schweiß auf die Handflächen zu jagen.
Mit dem Atem fängt das zweite Kapitel an, ein Atem der Panik, in schiere Angst versetzt, flach, schnell. Ein Atem kurz vor dem Moment, an dem der menschliche Kreislauf aufgibt und sich auf die Versorgung der lebenswichtigen Organe konzentriert. Eine Panik, die sich im Kapitel um Tessa fortführt. Sie hat nämlich eine weitere Bürde zu tragen, nicht nur die ihrer Arbeit, sondern auch die als Mutter des Kindes. Nebenbei wird sie von einer passiv-aggressiven Schwiegermutter und einer perspektivlosen Müdigkeit überwältigt, von der auch Elena geplagt zu werden scheint. Ein erster Hinweis darauf, wie sehr sich die beiden Frauen aus den verschiedenen Welten noch annähern werden. Die beiden Damen entwickeln sich parallel in den Kapiteln, die teils überschneidend und nicht chronologisch erzählt sind und sie verändern sich zudem gleichmäßig und in die gleiche Richtung; zur Flucht aus der Realität und eben dorthin, wo das Kapitel den Zuschauer abholt. Blanke Panik.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org