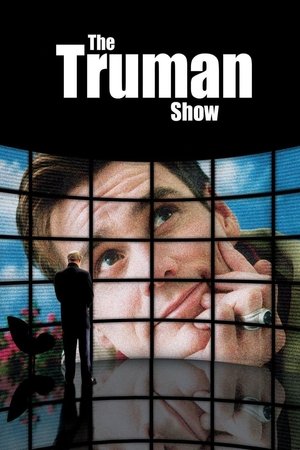Fredric Jameson, der Großvater der Postmoderne, diagnostizierte die 1950er Jahre einst als das „verlorene Objekt der Begierde“ für die Bürger der Vereinigten Staaten, als eine Zeit der fehlgeleiteten Nostalgie und des Glaubens an eine unerreichbare, ursprüngliche Unschuld. Regisseurin Olivia Wilde (Booksmart) scheint mit ihrem zweiten Spielfilm Don’t Worry Darling, an diese Theorie anknüpfen zu wollen, versetzt sie den Spielraum ihres High Concept Sci-Fi Thrillers eben in jene Epoche, wobei die, sich mitten in der Wüste befindende Kleinstadt, in der das Ehepaar Alice (Florence Pugh,Midsommar) und Jack Chambers (Harry Styles, Dunkirk) hausen, vielmehr den Eindruck einer utopischen Sekte macht, in welcher der charismatische Anführer Frank (Chris Pine, Wonder Woman), der diese Gemeinde „The Victory Project“ getauft hat, entschlossene wie versichernde Phrasen von sich gibt, welche an Jamesons sozilogischer Verhandlung dieser Nostalgie erinnern: Dieses, luxuriöse, abgesicherte Leben abseits der Zivilisation sei das „wahre“ Leben, entspräche der menschlichen Natur und sei noch nicht von einer, immer schneller werdenden, Moderne vergiftet. Don’t Worry Darling, man kann es erahnen, wird von der Flucht aus dieser Welt handeln, von der Realisation eines goldenen Käfigs der einen umgibt. Es ist eine in jeglicher Hinsicht lobenswerte, wie auch ambitionierte Geschichte, die Wilde hier erzählt, aber leider kommt sie ganze Dekaden zu spät und, glaubt sein Publikum ähnlich für dumm verkaufen zu können, wie Franks messianische Phrasen.
Ankerpunkt der Dekonstruktion dieses trügerischen Paradieses ist das Geschlechterrollenbild: Die Frauen des Victory Projects dürfen jeden Tag im Wellness von luxuriösen Traumhäusern schwelgen und müssen lediglich ihre Rolle als Hausfrau auszufüllen. Die Männer gehen jeden Tag einem mysteriösen Job in derselben Firma nach und niemand von ihnen darf über die eigene Arbeit ein Wort verlieren. Alice wird es letztendlich sein, die anfängt, diese trügerische Idylle zu hinterfragen und ist bald nicht nur dem Missmut der Gemeinde, sondern auch der Gefahr um ihr Leben ausgesetzt. Man kann diese typische „Platons Höhle“-Story gut an einem Bild beschreiben: Als Alice ihrem Mann, wie immer, dass wohlverdiente Abendessen zubereitet, bemerkt sie, dass in den Eiern in ihrer Küche sich kein Inhalt befindet, ein typisches, nahezu plattes Symbolbild für eine Existenz im Simulakrum, welches sich durch den Film ziehen wird. Die permanent beschworene Botschaft von der Rückständigkeit dieses Lebens wird wohl selbst die verklärtesten Republikaner*Innen nicht überraschen. Die völlig unglaubwürdige Hingabe mit der die Ehefrauen dieser Gemeinde sich diesem „wahren“ Leben im Luxus, aber in kompletter Ahnungslosigkeit, aussetzten, so viel sei verraten, wird im Verlauf des Filmes „Sinn“ ergeben, aber auch der ist zutiefst fehlgeleitet.
Wildes Film will uns von dem inhärenten Simulakrum dieser Existenz überzeugen aber ihr Film ist leider selbst ein solches Bild ohne Bedeutung: Surreale Traumsequenzen und an den Haaren herbeigezogenee Metapher-Bilder (die Wände kommen immer näher, weil Protagonistin Alice von ihrem domestizierten Leben erdrückt wird, versteht ihr?), vervollständigen die an David LynchsBlue Velvet angelehnte Suburbia-Dekonstruktion aber bereichern sie zu keiner Sekunde. Vielmehr erinnert Don‘t Worry Darling in seiner versuchten Emanzipation der Frau aus gesellschaftlichen Rollenmustern an neoliberalen T-Shirt Feminismus, inszeniert von einer Regisseurin, die wohl gerade erst gestern von der Definition des Begriffs „Patriachat“ erfahren hat. Wilde macht es sich so einfach, dass sie jede charakterliche Motivation völlig außer Acht lässt und alles auf ein hohles Gut-Böse-Schema herunter dummt. Ist Alice, zumindest energetisch von Florence Pugh gespielt, einmal von ihrem Gefängnis überzeugt, muss eigentlich nur davonrennen, dann kann sie sich befreien. Wie sehr sich regressive Ideologien im Geist eines Menschen manifestieren können, wie diese dazu verführen können, das eigene Gefängnis zu lieben, wäre hier ja eine interessante Frage gewesen, für die sich der Film aber nicht interessiert.
Stattdessen stolpert ihr Film durch längst offene Türen und wäre im gewohnt postmodernen „Our world is not real“-Ansatz besser im Kontext von Filmen wie Matrix oder anderen Suburbia-Filmen wie American Beauty der späten 1990ern angesiedelt. Im Jahr 2022 überraschen die Erkenntnisse von Don’t Worry Darling niemanden mehr. Als Gegenfilm sei hier ein Film wie Chantal AkermansJeanne Dielman empfohlen, in dem sich das Porträt eines Menschen, gefangen in erdrückender Routine eines Hausfrauendaseins, weder der zeitlichen Versetzung in die1950er, noch eines totalitären Sekten-Settings oder eines „Gaslighting“-Twists bedient und trotz seines über 40 Jahre zurückliegenden Ereischungsjahres tausendmal dystopischer, aktueller und verstörender daherkommt, als es Wildes Film es sich jemals wünschen könnte. Erfolgreich hat es Olivia Wilde geschafft einen Film von dem Ausbruch aus einer Simulation zu drehen, der selbst nichts kann als einen solchen Ausbruch zu simulieren, während er gleichzeitig an einen längst gefestigten Status Quo appelliert, welche sein Publikum nach dem Abspann weiterschlafen lässt. Während Akermans Film oder auch Peter Weirs Truman Show von dem grausamen Ausgeliefertsein des Individuums in der Gesellschaft handeln und dabei zeitlos bleiben ist Don’t Worry Darling jetzt schon so antiquiert und rückständig, wie die White Picket Fence-Kultur des Victory Projects selbst.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org