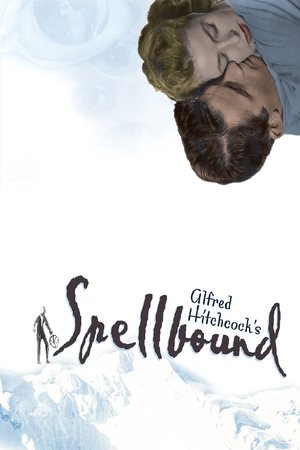Ohne jede erklärende Einleitung wird der Zuschauer bei „Die Nacht hat tausend Augen“ direkt in eine Szene befördert, die in der Regel dem Ende eines klassischen Film noir entspricht. Ein Mann irrt hektisch durch die Nacht, entlang der Gleise eines Güterbahnhofs. Er findet eine Damenhandtasche, er scheint auf der richtigen Spur. Ein Zug rauscht dampfend vorbei, als sein Blick auf eine Plattform am Ende einer Wendeltreppe fällt, von der eine junge Frau gerade im Begriff ist, sich in den Tod zu stürzen. Er erklimmt die Stufen und rettet die Verzweifelte, schließt sie in seine Arme. Ende gut, alles gut. Doch da sind wir noch lange nicht, auch nicht am Anfang. Wir starten in der Mitte einer Geschichte mit den Genre-üblichen Zutaten, angereichert mit übernatürlich-phantastischen Elementen.
Was zu diesem Beinah-Freitod geführt hat und was damit der undurchsichtige Illusionist John Triton (Edward G. Robinson, „Der kleine Cäsar“) zu tun hat, wird anschließend in fast ungewöhnlichen langen Rückblicken erläutert, zumindest für damalige Verhältnisse, in dem das lineare Erzählen noch selbstverständlicher war als heute. Triton selbst, der erst wenige Tage vorher in das Leben von Jean (Gail Russell, „El Paso“) und Elliott (John Lund, „Die oberen Zehntausend“) trat, indirekt für die Verzweiflungstat und sehr direkt für die schnelle Rettung verantwortlich ist, berichtet aus seiner bewegten Vergangenheit, genauer aus den letzten zwanzig Jahren, die ihn wie einen bösen Fluch verfolgen. Damals verdienten er und die späteren Eltern von Jean ihr Geld mit einer Hellseher-Bühnenshow, natürlich alles nur ein gewiefter Trick, simples Entertainment, dennoch verblüffend für das Publikum. Bis Triton angeblich wirklich begann, einen Blick auf zukünftige Ereignisse zu erlangen. Oft sah er persönliche Tragödien voraus, konnte einige davon verhindern, andere wieder nicht. Mehr Bürde als Segen, eine ungebetene Gabe, an der er langsam zerbrach und versuchte, sich dieser zu entziehen. Bis heute, denn jetzt wägt er auch Jeans Leben in unmittelbarer Gefahr und sieht sich in der Schuld, ihr Schicksal abzuwenden.
Wirklich? Für Elliott klingt das Ganze mehr als suspekt, schließlich ist bei Jean eine Menge Geld zu holen und das der Mann zuvor seinen Lebensunterhalt mit Tricks und Täuschungen verdiente, macht ihn nicht unbedingt seriöser. Alles nur raffinierter, hinterlistiger Betrug oder doch ein unerklärliches Phänomen? Ein hilfsbereiter, bedauernswerter Tropf, der alles aufgegeben hat und sich nun endlich dazu aufrafft, seine Fähigkeiten gezielt einzusetzen oder ein ausgekochter Scharlatan, der einen perfiden Plan verfolgt? Beides scheint durchaus möglich in dieser Kombination aus Film noir und einer Folge „Twilight Zone“ mit melodramatischen Einschlag. Relativ geschickt wird der Zuschauer durch die zunächst verwendete Erzählperspektive von Triton manipuliert, die natürlich keinen Zweifel an dem Wahrheitsgehalt seiner Aussagen zulässt. Schließlich „sehen wir ja selbst“ was passiert ist, wobei wir ja lediglich seine Geschichte bebildert bekommen und durch die Einseitigkeit der Narration ein trügerisches Gefühl der Gewissheit bekommen. Wie es ein Magier eben macht: Zeige deinem Publikum vermeidlich klare Dinge und verblüffe sie mit dem Unglaublichen. Wer einfach nur seinen Augen vertraut, verfällt der Magie des Effekts. Wer kritisch auf seinen Verstand vertraut, hegt berechtigtes Misstrauen. Sobald sich die Ereignisse wieder ins Hier und Jetzt verlagern, werden eben jene eher aus der Sicht von Elliott vorgetragen und somit auch der Zuschauer wieder in dessen Position gebracht. Ein schlaues Spiel mit den Blickwinkeln, aus dem „Die Nacht hat tausend Augen“ seinen durchgehend gegebenen Reiz bezieht.
Das dieser Kniff (meistens) vernünftig aufgeht, liegt nicht zu Letzt an dem hervorragend agierenden Edward G. Robinson, dem man seine Geschichte zu gerne abnehmen möchte, er verkauft sie schließlich so glaubhaft. Mit seinem traurigen, gütigen Blick, dem Erscheinungsbild eines vom Schicksal Geschundenen, mit dem man trotz seiner eigentlich als vorteilhaft interpretierbaren Fähigkeit nicht tauschen möchte. Nur der gesunde Menschenverstand und diverse Indizien sprechen dafür, dass man ihm doch besser nicht über den Weg trauen sollte, auch wenn viele seiner Visionen erstaunlich, gar erschreckend präzise zutreffen. Gleichzeitig ist man sich im Klaren, dass wenn einer die perfekte Illusion erzeugen könnte, es eindeutig er ist. Alles nur psychologisch-manipulativer Mumpitz, gezielt gestreute, selbsterfüllende Prophezeiungen, hochintelligenter Lug und Trug? Es scheint durchaus möglich, wie auch die Kehrseite der Medaille. In der Theorie wirkt „Die Nacht hat tausend Augen“ aus heutiger Sicht allerdings noch deutlich besser als in der Praxis, ganz so verwirrend und irritierend wie wohl seinerzeit ist er heute ehrlich gesagt nicht mehr. An gewissen Punkten ist er dann doch zu eindeutig in einer Richtung, der Überraschungseffekt kann nicht bis zum Schluss konstant gehalten werden. Dazu kommen einige leicht naive und unglaubwürdig konstruierte Momente (wie oft kommt es vor, dass ein Löwe aus einem städtischen Zoo ausbüchst?), man hätte aus der klugen Prämisse noch mehr machen können, auch schon zum Entstehungszeitpunkt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org