Der Roman Die Mittagsfrau von Julia Franck ist eingebettet in eine Klammer. Ein Prolog und Epilog, die nicht aus der Perspektive der Hauptfigur Helene erzählt werden. Die Verfilmung verzichtet darauf, was sich als gute Entscheidung erweist. Vorwissen kann als Spannungseffekt, als Suspense, sehr nützlich sein. Hier hätte es allerdings bedeutet, dass das Publikum bereits von Beginn an weiß, welche Schuld sich Helene aufgegurtet hat. Ein Damoklesschwert, welches es sicherlich erschwert hätte, ohne eine verfälschte Grundmeinung in die Geschichte einzutauchen sowie gemeinsam mit Helene auf ihre viele Jahre umspannende Lebensreise zu gehen. Eine Reise, die 1907 in Bautzen beginnt.
Das Wann, Wie und Wo wird dabei nie von Regisseurin und Co-Drehbuchautorin Barbara Albert (Licht) mit Texttafeln oder als Dialogen getarnten Expositionen preisgegeben. Die gesamte Romanverfilmung ist ein Werk voller Leerstellen, im Guten wie im Schlechten. Diverse Sachverhalte klären sich nach und nach auf, z. B. warum Helene in ihrem Nebenjob als Gehilfin in einer Apotheke ihren Vorgesetzten Geld gibt. Sollte es nicht andersherum sein? Es ist ein Film der Fragen, die meistens alle irgendwann beantwortet werden, in dem die Handlung und damit auch die Zeiten voranschreiten. Die Mittagsfrau lieferte eine Spannweite, die von Anfang der 1900 Jahre bis hin zur Nachkriegszeit geht. Und ja, der Zweite Weltkrieg spielt eine gewichtige Rolle, genau wie die Schicksale der wichtigsten und bedeutsamsten Menschen in Helenes aufwühlendem Leben.
Ein Leben welches bestimmt wird von Konformität und den ständigen Versuchen des Ausbruchs, die Regisseurin Barbara Albert nicht nur erzählerische, sondern auch visuell darstellt, in dem sie das Bildformat immer wieder ändert. Wenn Helene mit ihrer ersten großen Liebe (Thomas Prenn, Biohackers) über die nächtlichen Straßen tänzelt, wird das in voller Bildbreite präsentiert. Wenn sie jedoch Jahre später regelrecht in einer Beziehung gefangen ist, wirken die Bilder passenderweise eingeengt, fast wie gefilmt in Hochformat. Eine im Grunde einfache Technik, die bestens funktioniert und durchaus die Leistung der verschiedenen Darsteller*innen unterstreicht und unterstützt. Allen voran Hauptdarstellerin Mala Emde (Und morgen die ganze Welt), die sich die Rolle der Helene zu eigen macht und die ganze Palette von Menschlichkeit innerhalb von zwei Stunden rauf und runter spielt.
Die Romanverfilmung ist famoses deutsche Kino, trägt aber leider eine Eigenart mit sich herum, die dafür sorgen dürfte, dass einige keinen Zugang zu der Geschichte finden. Die benutzte Sprache ist so elendig verkünstelt, dass es elitär, kunstgewerblich wirkt. So toll das Spiel des Ensembles auch ist, so durchdacht und effektiv die audiovisuelle Gestaltung auch sein mag, die Sprache sorgt immer wieder dafür, dass das Drama ins Stolpern kommt. Mag sein, dass diese Artikulation in der literarischen Vorlage bestens oder besser funktioniert hat. In der Verfilmung erweist sie sich als Hürde. Dieses Hindernis kann überwunden werden und sollte es auch. Wer sich nicht bereit sieht, diese Überwindung zu meistern, dürfte zwei Stunden gemartert werden. Alle anderen erhalten einen emotionalen Ritt, der viel vom Publikum abverlangt, aber letztlich auch eine Menge bietet. Und sei es nur, dass hier so erzählt wird, dass man als Zuschauer*in noch gefordert wird und am Ende mit mehr sich ausdehnenden Gedanken aus dem Kinosaal herausgeht, als man hereingekommen ist.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org





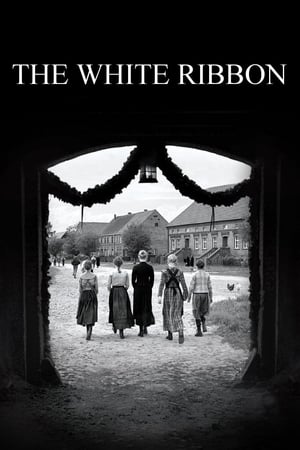



Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!