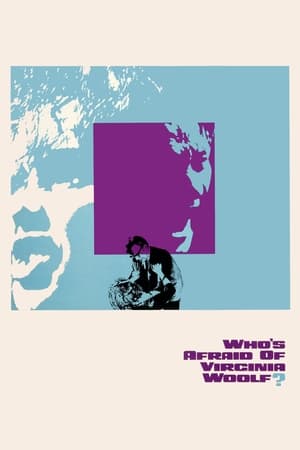„Ich hätte das ganze Europa erobern können, aber ich hatte Frauen in meinem Leben.“
Fröstelnde Erinnerungen werden wach, wenn Peter O’Toole (Lawrence von Arabien) und Katherine Hepburn (Leoparden küsst man nicht) in Der Löwe im Winter, der gleichnamigen, dreifach Oscar-prämierten Verfilmung des erfolgreichen Theaterstücks von James Goldman, mit spitzer Zunge übereinander herfallen. Erinnerungen an Mike Nichols zwei Jahre zuvor entstandenes Meisterwerk Wer hat Angst vor Virginia Woolf? , ebenfalls eine Theateradaption, dessen Hauptdarsteller, Elizabeth Taylor und Richard Burton, einen derart verstörenden Akt der (Selbst-)Zerfleischung darboten, dass nicht selten gemunkelt wurde, das damalige Ehepaar würde hier noch einmal die gemeinsamen Jahre auf der großen Leinwand Revue passieren lassen – und die Welt darf daran teilhaben. Auch das Bündnis, welches König Henry II. und Königin Eleonore von Aquitanien zusammenhält, ist gleichermaßen gesäumt von Liebe und Hass, von Zu- und Abneigung, von Stärke und Verletzlichkeit.
Anthony Harvey (Adlerflügel) macht mit Der Löwe im Winter dieser Tage vor allem wieder deutlich, dass ein gelungener Film nicht mehr benötigt, als eine Handvoll Schauspieler, die für ihre Rollen leben – und sterben. Jenseits von gigantomanischen Spezialeffekten, die letzten Endes doch nur den Zweck erfüllen, formalistische Augenwischerei zu betreiben, zählen in Der Löwe im Winter einzig und allein die Gesichter, die Gesten und die Positur. Die langjährige Freundschaft, die Peter O’Toole und Katherine Hepburn seit den frühen 1960er Jahren einte, trägt offensichtlich erheblichen Grund daran, dass sich die beiden Ikonen des amerikanischen Kinos in derartig formvollendete Sphären der Performancekunst aufschwingen konnten: Wer noch einmal Zeuge von eindrucksvollem Schauspielkino werden möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Der Einsatz dafür allerdings ist nicht zu unterschätzen.
„Macht ist die einzige Wahrheit.“
Als Zuschauer muss man schon mit einem gewissen Maß an Leidensfähigkeit gewappnet sein, um der Beziehung zwischen Henry II. und Eleanor gewachsen zu sein. Der Löwe im Winter schildert die Thronfolge Henrys als psychologische Tour de Force: Während der alternde König seinen buckeligen Sohn John (Nigel Terry, Troja) präferiert, spricht sich seine Frau Eleanor, die Henry seit Jahren in einem Verließ gefangen hält, weil sie sich einst in seine Politik und Administration einmischte, für den stolzen Richard (Anthony Hopkins, Das Schweigen der Lämmer) aus. Es entfaltet sich ein innerfamiliäres Geflecht der Intrigen; ein verräterisches Ränkespiel, in dem sich Eitelkeiten, Niedertracht und Grausamkeiten gegenseitig befeuern und potenzieren. Oftmals scheint es sich um einen Wettkampf dahingehend zu handeln, in dem es darum geht, die imposanteste Machtdemonstration auszuspielen.
Henry II. wählt einmal die treffenden Worte, dass „nichts im Leben zu vollkommen sein darf.“ Treffend, weil dieser Satz auch die feingliedrige Qualität von Der Löwe im Winter manifestiert: Die Charaktere sind so wunderbar fehlerbehaftet, geradezu getränkt in Verfehlungen, dass durch den Wust an Grausamkeiten immer wieder ein Funke unverdünnter Menschlichkeit Bahn bricht. Abseits der Durchtriebenheit, den Zynismen und der Tyrannei, die alle Beteiligten in krampfhaften Ausmaß an den Tag legen, zeigt sich wiederholt, dass sich Henry II. und Eleanor über die Jahre entfremdet haben, ihre Gefühlswelten füreinander aber noch lange nicht verwelkt sind. Gerade dieser Umstand, dass die Wucht der getätigten Aussagen simultan dazu auch die Fragilität der schweren Herzen freilegt, intensiviert das vielschichtige Geschehen.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org