Mit ihrem Dogma-95 Manifest sorgten Lars von Trier (The House That Jack Built) und Thomas Vinterberg (Der Rausch) einst für Aufsehen im europäischen Kino, zehn Jahre später waren die damals selbst auferlegten (und selbst nur selten wirklich konsequent verfolgten) Vorschriften Geschichte. Dear Wendy bricht jede der damals aufgestellten Regeln, scheint beinah wie eine Art „Befreiungsschlag“ und die Rückkehr zum herkömmlichen Kino – wenn so etwas im Kosmos rund um Lars von Trier überhaupt existiert. Dieser verfasste das Drehbuch, überließ die Regie aber seinem alten Kompagnon Vinterberg, der bereits zusagte, bevor er die finale Fassung gelesen hatte. Der Abschlussfilm des Fantasy Filmfest 2005 wurde wie von Trier-üblich kontrovers wahrgenommen, auch wenn lange nicht so umstritten wie einige andere seiner Werke. Im Kern wurde weniger die Thematik, sondern mehr die letztliche Qualität des Films diskutiert, der einerseits als bissig-zynische Satire aufgefasst wurde, sich aber andererseits auch mit dem Vorwurf der Scheinheiligkeit und Doppelmoral konfrontiert sah. Beides ist durchaus richtig, wobei hinterfragt werden muss, ob das Eine nicht sogar bewusster Bestandteil des Anderen ist.
Denn worum geht es denn in Dear Wendy, der mit einem melancholischen Liebes-, ja beinah Abschiedsbrief des Protagonisten Dick (Jamie Bell, Snowpiercer) an seine Geliebte Wendy beginnt? Wendy stellt sich dabei nicht als eine Person aus Fleisch und Blut heraus, sondern als eine Pistole, die eines Tages in den Besitz des jugendlichen Außenseiters aus dem Südsaaten-Bergarbeiter-Städtchen Estherslope gerät. Bald findet Dick Gleichgesinnte in Form anderer Teenager, die sich ausgestoßen und nicht wertgeschätzt fühlen, aber durch ihre Schusswaffen eine Passion und vor allem eine nie gekannte Art von Selbstbewusstsein entwickeln. Sie gründen den Club der „Dandies“, der aber klaren Regeln unterliegt. Oberstes Gebot ist der Pazifismus und der damit einhergehende Kodex, dass ihre Waffen niemals zum Töten – oder wie sie es später bezeichnen, zum „Lieben“ – eingesetzt werden dürfen. Sie sollen ausschließlich in ihrem geheimen Unterschlupf im stillgelegten Bergwerk-Schacht zum Einsatz kommen. In ihrer Subkultur endlich aufblühend und Anerkennung erhaltend grenzen sich die Kids bewusst immer mehr von der ihnen so fremden, „normalen“ Gesellschaft ab, auch in Form von Kleidung und Sprache. Und auch ihre Waffen werden personifiziert. Erhalten Namen und werden wie stimmberechtigte Club-Mitglieder behandelt, was dann zwangsläufig zum Problem wird, als äußere Faktoren irgendwann Einzug in diesen obskuren Mikrokosmos halten und das selbstaufgestellte, fragile Weltbild dramatisch zusammenfällt.
Obwohl hauptsächlich in Dänemark (zu einem gewissen Teil auch im Ruhrgebiet) gedreht und überwiegend mit europäischen Mitteln produziert ist die Geschichte natürlich in die USA verlagert, wenn Lars von Trier den widersprüchlichen Umgang der US-amerikanischen Gesellschaft mit Schusswaffen durch die Mittel des US-amerikanischen Kinos ad absurdum führt. Dabei werfen er und Vinterberg scheinbar sehr bewusst jede der ursprünglichen Dogma-95 Gesetze über den Haufen, was man ihnen vorschnell als Kapitulation vor dem eigenen Anspruchsdenken ankreiden könnte, aber schlussendlich genauso sarkastisch, hinterlistig und reflektiert ist wie viel Aspekte an diesem teilweise wirklich missverstandenen Film. Um einer Gesellschaft – oder auch einem Publikum – überhaupt den eigenen Spiegel vorhalten zu können, muss man erstmal gewährleisten, dass dieses den überhaupt zu sehen bekommt. Wie viele der potentiell hier an den Pranger gestellten Zuschauer*innen hätten den Film wohl gesehen, dessen Existenz auch nur am Rande wahrgenommen, wenn er nach der einst auferlegten Selbstlimitierung entstanden wäre? Vermutlich noch viel weniger, als es ohnehin schon der Fall war. Natürlich ist Dear Wendy damit noch ganz weit weg von Mainstream, Kommerz und Massenkompatibilität, aber er gibt sich von vornherein zugänglicher und einladender. Man könnte sich auch als Random-User zufällig darin verirren und ihn möglicherweise aus genau den falschen Gründen sogar mögen.
Denn natürlich ist das kein subtiles Arthouse-Meisterwerk, bei dem sich das Duo von Trier/Vinterberg nur an ein (oftmals ja als solches bezeichnet) „elitäres Kunst-Kino-Publikum“ richtet. Der Vorwurf der Doppelmoral steht vermutlich auch deshalb im Raum, da die Beiden am Ende offenbar dem hier angeprangerten Reiz der Waffennarretei selbst erliegen und ihre durch die Magie der Handfeuerwaffen aufgeblühten Coming-of-Age-Loser in einen Western-Showdown schicken, der sie zu tragischen Helden der unterdrückten Romantiker werden lässt. Genau dadurch wird doch erst die schon früh offengelegte Absurdität der Handlung nur noch auf eine selbstreflektierte Spitze getrieben. Die Hauptfiguren werden in ihrer naiven, unsinnigen und völlig realitätsfremden Selbstwahrnehmung zu einer selbstzerstörerischen und extrem fremdgefährdenden Bedrohung, obwohl sie immer darauf beharren, das genaue Gegenteil anzustreben. Das verfassungsmäßig geschützte Recht, eine Waffe zum Selbstschutz, als Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit wie der Aufrechterhaltung des Friedens zu tragen (und nicht etwa zur Aufwertung des eigenen Egos in einer vordergründig fromm und tugendhaften, in Wahrheit aber latent aggressiven und radikalen Gesellschaft), was schlussendlich erst zum echten Waffen-Problem führt. Dieses extreme US-amerikanische Problem- und Phänomen wird durch (das Abbild) eine extreme US-amerikanische Darstellungsweise persifliert. So gut – und deshalb in letzter Konsequenz auch nicht zwingend „leise“ und „subtil“ –, dass die Grenzen zwischen Ironie, ätzendem Sarkasmus und funktionellen Genre-Mechanismen beinah verschwimmen. Das ist nicht plump, das ist beinah brillant. Beinah…
 Trailer
Trailer




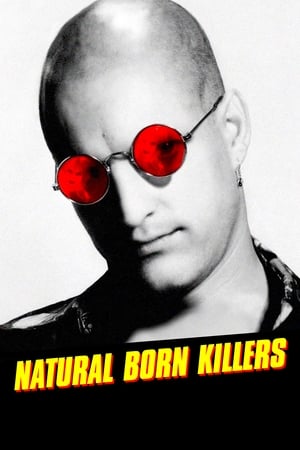
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!