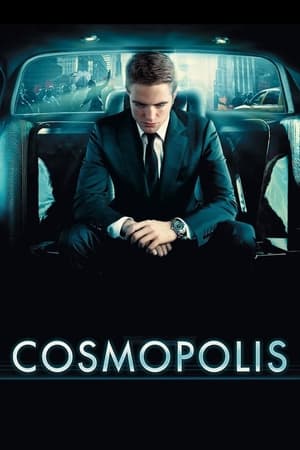„Der Junge war offenbar gerade erst runter gesprungen…er hätte auch uns treffen können!“
Das Kunsthändler-Ehepaar Flan (Donald Sutherland, 1900) und Ouisa Kittredge (Oscar-nominiert für die bereits am Broadway von ihr verkörperte Rolle: Stockard Channing, Grease) residiert in seinem Fifth-Avenue-Elfenbeinturm mit Blick auf den Central Park längst meilenweit vorbei an einem auch nur grob realistischen Weltbild, ist man doch inzwischen ausschließlich unter sich in der High Society von Manhattan unterwegs. Eine Welt errichtet auf Statussymbolen, angehäuftem Luxus im Überfluss und nur noch getriggert von Oberflächenreizen, bis eines Tages – während man eigentlich gerade einen millionenschweren, und bei ihrem wenig demütigen Lebensstil sogar existenziell wichtigen Deal abwickeln will – ein junger, blutender Farbiger namens Paul (in seiner ersten, größeren Filmrolle: Will Smith, Suicide Squad) vor der Tür steht. Ein Harvard-Kommilitone ihrer Kinder, der mit differenziertem Hintergrundwissen dieses zu bestätigen weis. Normalerweise würde man den ungebetenen Besuch auch dann nur notdürftig erstversorgen und schnellstmöglich wieder auf die Reise schicken, aber Paul macht innerhalb kürzester Zeit etwas mit dieser elitären Runde.
Fasziniert hängen sie an den Lippen des eloquenten, wortgewandten und offenbar hochgebildeten, Literatur-, Philosophie – und Malerei-bewanderten Studenten, der sie sogar fürstlich bewirtet und ganz nebenbei das unverzichtbare Geschäft für das Ehepaar im Vorbeigehen eintütet, ohne das die dafür einen Finger krumm machen müssen. Als er dann auch noch preisgibt, der Sohn von Hollywood-Legende Sidney Poitier zu sein, da bleibt selbst so einem hochnäsigen Paar wie den Kittredges nichts anderes übrig, als ihn auch über Nacht mit offenen Armen aufzunehmen. Der nächste Morgen birgt allerdings ein verstörendes Erwachen. Eigentlich könnte diese bizarre Episode - dieser Ausreißer innerhalb ihres sonst sehr geordneten, biederen und herablassenden Alltags – eine exotische Randerscheinung bleiben. So behandeln sie es auch zunächst, verwenden es als skurrile Anekdote auf Empfängen und Dinner-Partys, doch tatsächlich entwickelt sich daraus eine aufrüttelnde Kettenreaktion, die nicht nur ihnen, sondern auch ihrem vom gleichen Scharlatan heimgesuchten Bekanntenkreis mit fortlaufender Zeit die Augen öffnet. Oder es wenigstens tun sollte.
„Wer von euren Freunden von der Highschool ist inzwischen homosexuell geworden…?“
Regisseur Fred Schepisi hat in 40 Jahren meist nur sanfte, aber recht ordentliche Unterhaltung inszeniert (u.a. Roxanne oder Wilde Kreaturen), mit der Adaption des Bühnenstücks vom auch für das Drehbuch verantwortlichen John Guare (Atlantic City, USA) wagt er sich über den eigenen Tellerrand anspruchsvoll und erfolgreich hinaus. Mag besonders der Beginn etwas sperrig und ähnlich narzisstisch, intellektuell-affektiert auftreten wie seine Figuren, genau das ist Teil der hintergründig-ironischen Demaskierung der selbstbesoffenen Oberen Zehntausend, die nur Ihresgleichen akzeptieren und gar nicht bemerken, wenn sie mit eben solchen aufgesetzten Attitüden und selbstverliebter Arroganz hinters Licht geführt werden. Wenn sie Opfer der eigenen, nicht mehr vorhandenen Bodenhaftung werden und plötzlich komplett schockiert sind, wie einfach sich jemand von ganz unten bei ihnen spielend einnisten konnte. Raffiniert über mehrere Ecken und Positionen meist rückblickend erzählt, entlarvt sich der furchtbar (und sinnentleert) „eingedeutschte“ Das Leben – Ein Sechserpack (Six Degrees of Separation) als ein garstiges Gesellschaftsstück, das kaum ein gutes Haar an der elitären Oberschicht lässt. Die ein betrügerisches, kriminelles Phantom jagt und wenigstens in Teilen dadurch erst realisiert, was bei ihnen bereits seit Jahren – spätestens seit dem Aufstieg in angebliche Sorglosigkeit – erheblich schief läuft.
Nicht umsonst kann sich der falsche Fünfziger problemlos als enger Kumpel ihrer Kinder ausgeben – denn wann haben sie zuletzt ernsthaft mit ihnen geredet? Erschreckend offenbart in den hier gezeigten passiv-aggressiven Aufeinandertreffen, die von desinteressierter Gleichgültigkeit und daraus resultierender, verbitterter Anti-Haltung zeugen. Wohl auch deshalb war der angebliche Freund ein so gern gesehener Gast, denn wenn schon die eigenen Kinder einem nur noch negativ gegenüberstehen, wie Balsam muss die wohlwollende, um Annährung bemühte Präsenz von Paul dann auf sie gewirkt haben? Eine Wiedergutmachung, deren Notwendigkeit man sich in seinem Heiligenschein-gleichen Unrechtsbewusstsein natürlich nie zugestehen würde. Langsam, aber sicher und unnachgiebig wird das nach außen prachtvolle, aber nach innen mehr traurige und selbstbelügende Gebilde zerpflückt. Die feinen Damen und Herren werden als aufgescheuchter Hühnerhaufen immer weiter der Lächerlichkeit preisgegeben, was zwischenzeitlich die neurotisch-analytische Qualität von Woody Allen (Manhattan) oder Robert Altman (The Player) erreicht. Das Leben – Ein Sechserpack wirkt ab einem gewissen Punkt gar wie eine verzerrte Interpretation von Die Glücksritter: Ein soziales Experiment, was aus einer Schnapsidee geboren zum unkontrollierten Selbstläufer wird, nur diesmal den Humor als Nebenaspekt verwendet.
Im letzten Drittel löst sich der Film endgültig von einer eventuell vorher noch vorgetäuschten Borniertheit. Welche er bewusst ein Stückweit evoziert. Wie geschwollen, übertrieben eloquent, prätentiös und elitär sich anfangs gegeben wird (womit zumindest teilweise auch der Film an sich gemeint ist), es dient lediglich der Darstellung eines selbstgefälligen Ist-Standes, der im weiteren Verlauf gehörig ins Wanken gerät. Weshalb sich der Schlussspurt und Epilog als fast erschütternd herausstellen. Nichts und niemand ist so wie er sich meint darstellen zu müssen, aber am Ende bleibt scheinbar nur noch eine verlogene Selbstwahrnehmung, die irgendwann zur angeblichen Wahrheit mutiert. Und wenn die zerbricht, sind die Folgen katastrophal. Das emotionale wie narrative Nachbeben der Geschichte, es ist viel größer als man zunächst vielleicht annehmen könnte. Kein Mensch steht wirklich über dem anderen und eigentlich sind wir uns viel näher, als das die Meisten oft wahrhaben wollen. Gerade die, die glauben etwas zu verlieren zu haben.
-„…wieviel ich davon rechtfertigen kann? Alles! Ich bin ein Spieler!“
-„Das ist furchtbar, dieses Spiel!“
 Trailer
Trailer