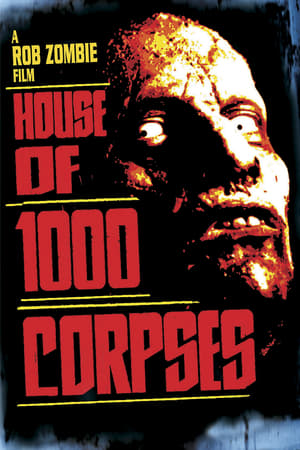In der Vita von Horrorfilm-Legende Wes Craven (Nightmare – Mörderische Träume) „genießt“ Das Haus der Vergessenen (der Originaltitel The People Under The Stairs ist natürlich wesentlich schöner und individueller, leider auch in der Nähe eines Spoilers) eher ein Schattendasein, was auf verschiedene Gründe zurückzuführen ist. Mal ganz abseits von Inhalt und Form ist sein Entstehungs- und Veröffentlichungszeitraum sicherlich einer der ungünstigsten für das Genre generell. 1991 war die ganz große, durch den VHS- und Videothekenboom wirklich goldene Ära des B-Horrorfilms schon längst vorbei, selbst Franchise-Goldgruben versiegten und wenn schon die Fans langsam das Interesse verloren, waren das allgemeine Publikum und Kritiker erst recht nicht dafür zu begeistern. Zwar erzielte der Film immer noch ein respektables Einspielergebnis an den Kinokassen und konnte als finanzieller Erfolg betrachtet werden, trotzdem verschwand er danach in der Nische des inzwischen verpönten Genres. 5 Jahre später sollte der gleiche Regisseur mit Scream - Schrei! dieses wieder massentauglich und lukrativ machen, was seltsamerweise bald noch mehr zu anschwellenden Anonymität dieses Films beitrug, der einfach nicht mehr dem Trend der Zeit entsprach.
Soviel zu zeitlichen Kontext, aber natürlich ist es auch der ziemlich exzentrische Inhalt, der Das Haus der Vergessenen auch heute noch zu einem schrägen und manchmal leicht gewöhnungsbedürftigen Vertreter seiner Zunft macht. Welche auch immer das sein könnte, denn eigentlich gibt es gar keine klare Schublade, in die sich dieser Tausendsassa korrekt einordnen ließe. Schubladendenken ist scheiße und das Loslösen davon selbstverständlich hochinteressant, was klar zu den größten Stärken dieses Werkes zu zählen ist, auch wenn die Mischung in der Tat sehr vieles - mitunter zu vieles - versucht unter einen Hut zu bringen. Eine skurrile Mixtur aus urbaner Gruselgeschichte um ein unheimliches Haus in der Nachbarschaft, über die scheinbar jeder mal etwas gehört, aber niemand sich je davon überzeugt hat. Aus gesellschaftlicher Allegorie über soziale Missstände; aus eine Art umgedrehte Form des Home-Invasion-Thrillers; aus einem Beinah-Creature-Horrofilm; aus grotesker, pechschwarzer Komödie und zu einem nicht geringen Anteil aus einem Jugendfilm mit Anleihen zum klassischen Märchen.
Der 13jährige „Fool“ (Brandon Quintin Adams, Moonwalker) betritt – wie es sein Spitzname vorgibt – als unbedarfter, kindlich naiver Narr ein dunkles Labyrinth, eine abgeriegelte Festung mitten in seinem heimischen Ghetto, um dort einen Schatz zu finden, der seiner Familie den Erhalt der Wohnung und seiner totkranken Mutter die lebensnotwendige Operation ermöglichen soll. Was er vorfindet, ist ein bizarrer, verwinkelter Höllenschlund, kreiert und beherrscht von einem sonderbaren Pärchen (schon in Twin Peaks Seite an Seite: Everett McGill & Wendy Robie), welches weit mehr zu verstecken hat als nur eine Sammlung von wertvoller Goldmünzen. Ganz oben im „Turm“ wartet eine geschundene und unschuldige „Prinzessin“ namens (wie auch sonst in diesem grauenvoll-verrücktem Wunderland) Alice auf Rettung, während im Keller, unter den Stufen und zwischen den Wänden noch ganz andere, arme, verstoßene und misshandelte Seelen sich von den Brocken ernähren müssen, die ihnen ihre „Herrchen“ zum Fraß vorwerfen.
Wes Craven pendelt bei Das Haus der Vergessenen immer wieder zwischen typischen Horrorfilmmotiven (unheimliches Geisterhaus, kindliche Schreckgespenster), blankem Psychoterror mit teilweise harten Themen (Kindesentführung- und Missbrauch, Inzest, Kannibalismus und Zwangskastration) und absurd-überdrehter Slapstick auf Cartoon-Niveau hin und her, scheint manchmal eine Geschichte erzählen zu wollen, die an seiner angepeilten (?) Altersgruppe komplett vorbeigeht. Bedient Bedürfnisse eines kindlich-heranwachsenden Gruselabenteuers, aber mit extremen Zutaten, die nicht nur angedeutet werden. Das führt gelegentlich zu Irritationen, sobald man sich jedoch auf die etwas eigenwillige Form eingelassen hat und über einige deutlich zu alberne Momente hinwegsieht, entwickelt der Film einen faszinierenden Sog, der gerade wegen seines entfesselten, regellosen Unfug teilweise erfrischend auftrumpft. Everett McGill und Wendy Robie drehen zu hemmungslos, wild grimassierend am Rad und das Tempo steigert sich im furiosen Schlussakt so dermaßen konsequent, dass man diesem wüsten Crossover so manche Ausrutscher gerne verzeiht. Letztlich ist der Mut so etwas in der Form überhaupt zu drehen schon äußert beachtlich, dass es sogar über weite Strecken trotz einer berechtigten, nicht gänzlich wiederlegten Skepsis ziemlich gut funktioniert nicht minder.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org