Manche Aufgaben sind echt undankbar, obwohl Fachleute am Werk sind. Besonders, wenn beide nicht ihren besten Tag haben.
Selbst wenn man nicht im Horrorgenre zu Hause ist, diese zwei Namen dürften beinah jedem Menschen etwas sagen: Kultautor Stephen King („Es“) und Kultregisseur John Carpenter („Die Mächte des Wahnsinns“), in ihrem Bereich feste Größen (zumindest über einen langen Zeitraum) und 1983 trafen sich bei „Christine“ ihre Wege. King-Verfilmungen besitzen generell einen zwiespältigen Ruf: Die Vorlagen sind oft (als reine Unterhaltungsliteratur) über jeden Zweifel erhaben, die Adaptionen gelten flächendeckend als eher misslungen, mit wenigen, allgemein gefeierten Ausnahmen (z.B. „Misery“,„Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“, „Die Verurteilten“). Selbst der brillante, aber natürlich extrem individuelle „Shining“ von Stanley Kubrick („2001 – Odyssee im Weltraum“) wurde gleichermaßen gelobt wie verrissen. Ähnlich scheiden sich auch bei „Christine“ die Geister. Einerseits als eine der angeblich wenigen gelungenen King-Filme gehandelt (dabei gibt es eine zweistellige Anzahl der Verfilmungen, die sich klar lohnen), andererseits als eine weitere Enttäuschung und einer der schwächeren Filme von John Carpenter. Zumindest die letzte Aussage trifft leider zu, obwohl das den Film immer noch nicht als kompletten Flop brandmarkt.
Man muss immer im Auge behalten, was denn möglich war. „Christine“ besaß im Buch schon die reizvolle und im Grunde clevere Grundidee, den Spätzünder-Coming-of-Age-Prozess eines Außenseiters über die Liebe zu seinem Auto diabolisch-phantastisch zu erzählen. Keine Frau, ein Auto macht den Waschlappen Arnie (in seinem darstellerischen Wandlungsprozess gut: Keith Gordon, „Dressed to Kill“, seit Jahren vermehrt als Serien-Regisseur tätig, u.a. „Dexter“) zum Mann. Zumindest keine Frau im biologischen Sinne. Seine Christine entjungfert ihn, knackt die schüchterne, wenig selbstbewusste Nerd-Schale; die zertrampelte, geflickte Hornbrille sitzt nur noch kurz auf der Nase. Sobald er sich ganz seiner wahren Liebe hingegeben hat, verändert sich Arnie. Scrabble-Abende mit den Eltern, bei denen „anstößige“ Worte nicht akzeptiert werden, gehören der Vergangenheit an. Nun schraubt und bastelt der Einzelgänger Tag für Tag an seinem Plymouth, der sich unnatürlich schnell vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan verwandelt. Wie auch Arnie. Seine Erzeuger erkennen ihren braven, gefügigen Sprössling nicht wieder, eben so wenig sein bester (und einziger) Freund Dennis (John Stockwell, „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“), dem das Nachtschattengewächs langsam den Rang abläuft, sich vor ihm die Gunst des neuen, heißen Highschool-Fegers Leigh (Alexandra Paul, „Mad Men“) sichert. Christine hat Arnie verändert; Christine, die alte Rostlaube, ist erblüht und mit ihr Arnie. Eine Symbiose, die nichts neben und zwischen ihr duldet. Nichts ist gefährlicher als eine eifersüchtige Frau, die zu allem bereit ist.
Darauf konzentriert sich die Adaption, lässt dafür einen Aspekt des Buchs aus, in der Christines Vorbesitzer eine deutlich wichtigere Rolle einnahm. Theoretisch ist dies sogar vergleichbar mit der Variante von „Shining“: Dem Film wird eine übernatürliche Komponente genommen, die im Buch nicht irrelevant war und für diverse Abweichungen sorgt. Allerdings: Nicht gänzlich, nur wenig die Idee verändernd. Es geht eher in die Richtung von „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“, der etwas weglässt, um sich auf einen Schwerpunkt mehr zu konzentrieren. Das ist grundsätzlich völlig okay, wenn es denn Sinn macht. Bei „Christine“ ist es sogar der Fall, nur leidet der Film unter den gleichen Problemen wie das Buch: Beide haben eine schöne Idee, die verpackt ist in eine leicht alberne. Ein selbstheilendes Auto tötet Menschen. Im Roman sicher noch besser verkauft durch die zusätzlichen Details, im Film wirkt das mehr als einmal etwas cheesy (wenn auch tricktechnisch für seine Zeit einwandfrei). John Carpenter hat daran wenig Schuld, obwohl er nach seinen Glanzleistungen zuvor (von „Assault – Anschlag bei Nacht“, 1976, bis „Das Ding aus einer anderen Welt“, 1982, sind seine Kinoproduktionen alle unanfechtbar) auch nicht die ganz große Klasse halten kann. Wenn Christine nach ihrer „Schändung“ (hier erreicht die Vermenschlichung des Autos einen Höhepunkt: Wie in einem Rape & Revenge-Thriller) zu Carpenters gewohnten, selbstkomponierten Synthesizerklängen als lodernder Racheengel Vergeltung übt, ist das aber fraglos großartig. In diesen gespenstischen Momenten sind wir nah an dem, was John Carpenter-Filme dieser Zeit auszeichnete.
Problematisch sind eher Dramaturgie und Spannungsbogen. „Christine“ steigert sich nur gemächlich, ist auch für Nichtkenner der Vorlage zu absehbar und bietet ein eher unspektakuläres Finale (gerade da werden Fans des Buches enttäuscht werden, aufgrund der üblichen Kürzungen). Mal abgesehen von den Figuren, die wenig Zweifel daran hegen, dass ein Auto ein Eigenleben entwickelt. Stimmt in dem Fall zwar, aber das zu glauben aufgrund dieser Vorfälle, naja, von (beinah) erwachsenen Menschen sollte man etwas mehr Sinn für die Realität erwarten. Das rückt die Geschichte und den Film insgesamt unfreiwillig in eine leichte Trashecke, wo er an sich nichts zu suchen hat. Bei King funktionierte das aufgrund der (natürlich) ausführlicheren Beschreibung und den bereits angesprochenen Plot-Abweichungen deutlich besser, auch wenn schon das Buch nicht zu seinen stärksten Arbeiten gehörte. Mehr als ein ganz nett gemachtes, aber schlussendlich nur minimal überdurchschnittliches Vergnügen springt somit nicht heraus, trotz sichtlicher Bemühungen und schönen Details (die musikalische Untermalung sei besonders genannt).
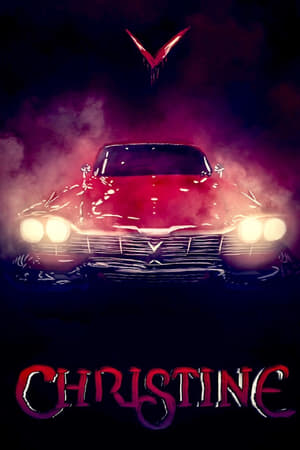 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
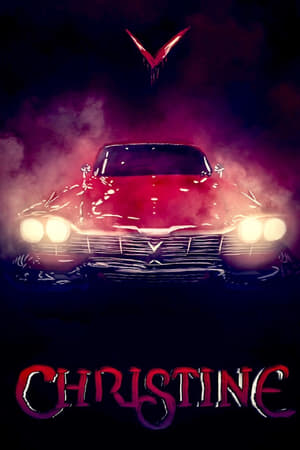











Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!