Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das ist sowohl der markante Titel eines Filmes von Rosa von Praunheim, wie auch die entscheidende Erkenntnis, die Joel Edgerton aus seiner zweiten Regiearbeit nach dem hinterlistigen Psycho-Thriller The Gift herausdestilliert. Basierend auf den Memoiren von Gerrard Conley verfolgt Der verlorene Sohn den 19-jährigen Jared (Lucas Hedges, Mid90s), der nach seinem Outing in eine Art christliches Umerziehungscamp geschickt wird, wo ihm zusammen mit einer Gruppe Leidensgenossen nicht nur beigebracht wird, sich wie ein richtiger Mann zu bewegen, sondern auch das Schwulsein grundlegend ausgetrieben werden soll: Wer seines gleichen Geschlechts begehrt, der wird früher oder später von Gott verlassen. In den Vereinigten Staaten sind derartige Reperativtherapien noch immer gang und gäbe.
Alles beginnt damit, dass wir Jared im Kindesalter vorgestellt bekommen: Ein aufgeweckter, kleiner Junge, der sich für Basketball und Fußball begeistert, Blau und Gelb zu seinen Lieblingsfarben zählt und später einmal sein Geld als Motorradfahrer verdienen möchte. Nachdem Jared seinen Eltern Nancy (Nicole Kidman, Aquaman) und Marshall (Russell Crowe, American Gangster), ein Baptistenprediger, mit zittriger Stimme gesteht, sich zu Männern hingezogen zu fühlen, bricht der gottesfürchtige Haushalt regelrecht in sich zusammen. Der verlorene Sohn, dessen Drehbuch ebenfalls Joel Edgerton verfasst hat, entfaltet sich dabei vorwiegend über zwei Erzähl- und Zeitebenen: Er zeigt in Rückblenden immer wieder die Erfahrungen, die Jared gemacht hat, bevor er sich dem Konversions- und Reorientierungsprogramm unter Victor Sykes (Edgerton) anschließen sollte, um dann wieder den restriktiven Alltag innerhalb der Therapie zu beschreiben.
Auch wenn es nach dem fürchterlichen Trailer nahezu unglaublich erscheint, ist Der verlorene Sohn tatsächlich ein bis zuletzt äußerst subtil gestaltetes Charakter-Drama, welches gezielt und durchaus gekonnt vermeidet, dem Thema sensationsheischend zu begegnen. Edgerton hält den Fokus streng auf der Gefühlswelt seines Hauptdarstellers, der sich zusehends in einem inneren Kampf mit sich selbst befindet, um am Ende die Erkenntnis für sich zu gewinnen, dass nicht seine Sexualität das Problem ist, sondern der erzkonservative Kosmos, in dem er aufgewachsen ist. Anstatt sich zu theatralischen Überspitzungen hinreißen zu lassen, die ein einfach gestricktes, mit klaren Bösewichten ausgestattetes Charakterkonstrukt hervorbringt, formuliert sich Joel Edgerton ambivalent und erkennt auch in den Leitern des Umpolungsprogramm viel Angst vor der eigenen Identität, den eigenen Bedürfnissen, der angeblichen Widernatürlichkeit. Fragile Männlichkeit, überall.
Der verlorene Sohn ist damit vor allem eine Anklage an die unzeitgemäßen Gepflogenheiten des religiösen Fundamentalismus, der evangelikale Christen in ganz Amerika dazu bringt, geflissentlich ihre Kinder seelisch wie physisch misshandeln zu lassen. In leisen, zielgerichteten Tönen äußert der Film sein Unverständnis, seine Wut, seine Enttäuschung, vollbringt es aber trotz seiner inszenatorischen Umsicht und den formidablen Schauspielleistungen nie wirklich, die tiefe emotionale Zerrissenheit seiner Protagonisten körperlich dichter Ausformung erfahrbar zu machen. Tatsächlich ist Der verlorene Sohn ein Werk, das irgendwann selbst an seiner Nüchternheit leidet, weil es sich immer mehr in dem Anspruch verkapselt, sein Sujet niemals zu reißerischen Zwecken ausbeuten zu wollen. Das nimmt Edgertons routinierter Regie die Kraft dahingehend, bis zu urwüchsigen, nachhaltigen Gefühlsbewegungen vorzudringen. Der finale Versöhnungsansatz hängt damit auch ein Stück weit in den Seilen, sehenswert aber ist Der verlorene Sohn zweifelsohne.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org














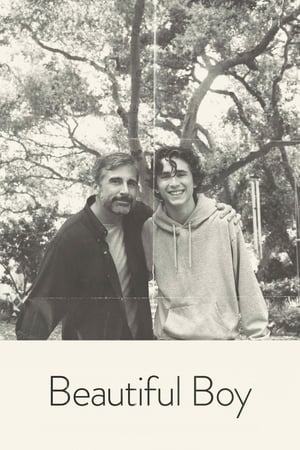

Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!