„Life is a series of idiotic images”
Wie egozentrisch kann man sein zu glauben, man könnte das Leid der ganzen Welt in sich tragen? Ein derartiges Vorhaben würde wohl jeder halbwegs vernünftige Mensch als absurde Selbstbeweihräucherung abtun und damit vermutlich recht behalten. Wer seine Filme kennt, der weiß das Alejandro González Iñárritu (Amores Perros, Biutiful) nicht so ein vernünftiger Filmemacher ist, greift der gebürtige Mexikaner doch immer wieder nach einer poetischen Essenz des Schmerzes: Seine Figuren erklärt er feierlich zu Märtyrern, die ertragen und erleiden, die sich ohne Lohn durch den angehäuften Dreck einer gottverlassenen Erde kämpfen müssen. Was steckt dahinter, wenn nicht mehr als reine Behauptung zum Zwecke fehlgeleiteter künstlerischer Integrität? Mit derartigen Fragen nach dem Sinn und Nutzen des eigenen Œuvres beschäftigt sich Iñárritu mit seinem hypnotischen Fiebertraum-Epos Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten zwar nicht zum ersten Mal, verteidigte er die Macht der Kunst gegen die gierigen Klauen des Kommerzes doch bereits in seinem Oscar-Sieger Birdman. Doch statt Michael Keatons entnervtem Faustschlag auf den Tresen bei der Konfrontation mit einer Kritikerin formuliert Iñárritu hier seine eigene Verteidigung als metaphysisches, sich ewig entziehendes Fragezeichen.
Die erbarmungslose Wildnis aus The Revenant wird dabei eingetauscht gegen die endlose mexikanische Wüste, in der wir in der Eröffnungseinstellung nur den Schatten unseres Protagonisten sehen. Die Wüste als wiederkehrendes Motiv bildet dabei einen liminalen Ort der internen Transition. Gefangen in einer befremdeten, fast an ein Videospiel erinnernden Egoperspektive fangen wir plötzlich an zu springen und schließlich zu fliegen, eine horizontale Reise durch das Leben von Journalist und Dokumentarfilmer Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho, Zama) beginnt. Das erste mal in einem real erscheinenden Szenario sehen wir ihn in der Straßenbahn von Los Angeles, in den Händen hält er einen Beutel Wasser in welchem drei Axolotl umher schwimmen. Ehe wir uns versehen, ist der gesamte Bahnwagon durchflutet und Silverio lässt sich schließlich in seine alte Wohnung in Mexiko treiben, seine, von sozialem und politischem Leid befallene, Heimat, die er zugunsten der Welt der Reichen und Schönen von Kalifornien aufgab. In der visuellen Logik von Bardo sind räumliche und zeitliche Regeln aufgehoben, die entfesselte Kamera von Darius Khondji (Uncut Gems) scheint an keine Grenzen gebunden. Iñárritu rahmt dabei gewohnt bildgewaltige Aufnahmen, die Meere und Wüsten wie Räume und Wohnungen wie Landschaften wirken lassen, wobei jeder präzise Schwenk sich so anfühlt, als würde er die Säulen der Erde erschüttern und den Zuschauenden unangekündigt in das nächste Szenario befördert.
Wie alle Filme von Iñárritu ist Bardo nicht arm an Metaphern. Eine der zentralsten etabliert der Film relativ zu Beginn: Silveros neugeborener Sohn weigert sich auf der Welt zu bleiben, weil diese einfach zum schlimm ist, und wird dementsprechend wieder in den Schoß seiner Mutter zurückgeschoben. Das Motiv dieses Bildes wiederholt der Film mehrfach in neuen Facetten: Der „zurück-geborene“ Sohn als radikale Negierung einer Transition. Im Kontext von Silveros Reise als Filmemacher, bei der man autobiografische Züge von Iñárritu selbst gerne reininterpretieren kann, steht das Bild auch für eine radikale Realitätsverweigerung: Silvero dokumentiert die von Armut und Heimatlosigkeit gestraften Bürger Mexikos und wird durch jene Aufnahmen reich und berühmt. An einer Lösung dieses Konfliktes zwischen Aufklärung und Ausbeutung ist der Film genauso wenig interessiert wie sein Protagonist, der später, als seiner Haushälterin der Zugang zu einem luxuriösen Strandbad verweigert wird, auch nach zornigen Protesten seiner Familie einfach entspannt durch den Eingang wandert.
Dieser Konflikt brodelt im Off eines Filmes, dessen Tragweite gigantisch wirkt und dennoch durch scheinbar blinde Flecke vergiftet wird. Der Begriff „Bardo“ entstammt aus dem Tibetanischen und beschreibt das buddhistische Konzept des Zustandes zwischen Tod und Wiedergeburt. Silvero tanzt ewig in ausgelassenen Clubs und Preiszeremonien um seine eigene Wiedergeburt herum und wird von ihr schließlich doch in Form eines visuellen Fiebertraums heimgesucht, dessen Rahmen der Film selbst bildet. Wie ironisch, dass im Herzen des wohl umfangreichsten und ambitioniertesten Filmes eines der gefeierten Filmemachers der Gegenwart doch ein Testament über das Scheitern steckt: Das Versagen, die Widersprüche der Existenz aufzulösen oder ein ganzes Leben in Bilder zu fassen, geschweige denn ein kollektives Leid durch ein individuelles zu ersetzen. Einem ewigen Egozentriker wie Iñárritu kann man ein größeres Kompliment kaum verleihen als jenes Zugeständnis des eigenen Scheiterns. Natürlich scheitert Bardo als Film zu keiner Sekunde, aber die enigmatische Struktur des Filmes öffnet ihn als transzendente Selbstsuche, welche erhaben der Frage entgegenblickt, wer wir sein werden, wenn wir das Ende der Wüste erreicht haben.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
















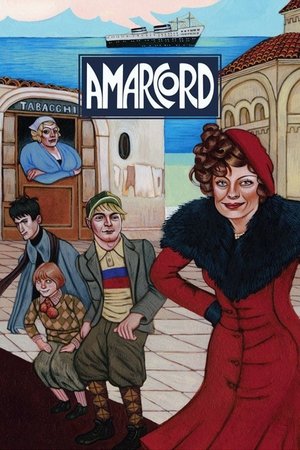


Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!