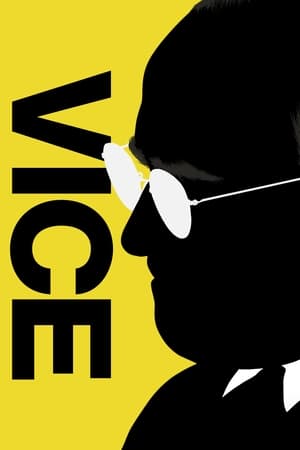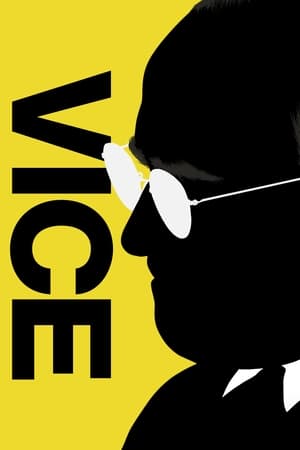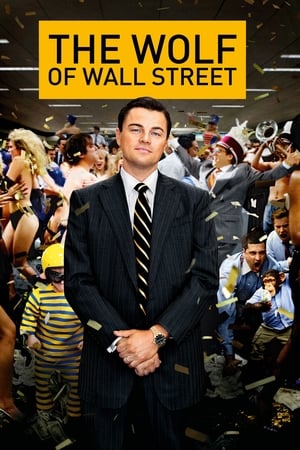„How the fuck did this happen?” Michael Moore stellt diese Frage im Trailer zu seiner neuesten Dokumentation, Fahrenheit 11/9. Begleitet und mit Dringlichkeit versehen wird sie von Bildern, die seit beinahe drei Jahren durch die Medien geistern: US-Präsident Donald Trump in siegessicheren Posen, hinter Mikrofonen, vor Menschenmassen, auf roten Teppichen, die ihm zu Füßen ausgerollt werden. Moore ist ein Regisseur, der seit jeher faszinierte wie schockierte Abstiege in die amerikanische Psyche unternommen hat, mit mal mehr, mal weniger erhellenden Schlussfolgerungen. Immer aber bildeten menschliche Schicksale den Rahmen für seine manipulativen Erzähl- und Inszenierungsstrategien; ein Umstand, der diese gleichermaßen effektiv wie fragwürdig gestaltet.
Regisseur Adam McKay (Anchorman, Step Brothers) hat sich im Verlauf der letzten Jahre von seinen Knallchargen-Komödien ab- und dieser Form des Kinos zugewandt. Diesem – vermeintlich – seriöserem Kino, das politische und wirtschaftliche Sachverhalte mit reichlich Humor versetzt und ausbuchstabiert. Als angestrengte Scorsese-Emulation, samt frecher Erzählerstimme, unvorteilhaften Standbildern und Brüchen der vierten Wand, dabei aber auch stets um den eigenen Anspruch an ebenjene Seriosität bemüht. Der Zuschauer soll lachen, aber sich eben auch schlecht fühlen. Soll Spaß haben mit diesen Figuren, aber sie eben auch verachten. Soll unterhalten, aber eben auch informiert werden. „How the fuck did this happen?“ In Vice, seinem neuen Film, stellt McKay genau dieselbe Frage.
Angewendet wird sie von ihm auf den Aufstieg Dick Cheneys, der von 2001 bis 2009 das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten unter George W. Bush innehatte. McKay verfolgt Cheneys politischen, teils auch familiären Werdegang in einer elliptischen, stets um dieselben Bilder und Schlüsselmomente kreisenden Geschichte, scheinbar mit dem Ziel, eine assoziative Erzählqualität zu entwickeln. Auf der Leinwand bleiben aber nur Puzzlestücke, die nie ineinandergreifen. Vice ist ein regelbefreiter Film in der Hinsicht, dass er viele inszenatorische Ideen in sich vereint: Verspielte Fisch-an-der-Angel-Metaphern, halb-dokumentarische Montagen aus Archivmaterial, aus dem Totenreich noch durch die Geschichte dirigierende Erzählerfiguren. Nicht nur sind die meisten dieser Ideen aber wenig geistreich, sie sind auch immer nur lose, freischwebende Versatzstücke. Der Film zerfasert vor den Augen seines Publikums.
McKay gelingt es nicht, ein glaubhaftes Interesse für die Figuren aufzubringen, von denen er erzählt. Als würde er sich nur mit schlechten Witzen aus der Unmenschlichkeit ihrer Taten zu entwinden wissen, bläst er seinen Film immer wieder zur ironisierten Groteske auf. Die ist aber nie komisch, sondern stets nur ein befremdliches Vakuum aus wirr zirkulierenden Bildfragmenten, das sich allem Menschlichen entsagt zu haben scheint. Die Liebe zu seiner Ehefrau Lynne, die aber stets nur Anhängsel sein darf, könnte die treibende Motivation hinter den politischen Übeltaten gewesen sein, legt der Film nahe. Das Bedauern selbstverschuldeten familiären Versagens möchte man in Cheneys Gesicht ablesen, wenn er die Entzweiung seiner Töchter im Fernsehen mitverfolgt. Die wenigen Ansätze inhaltlicher Auseinandersetzung mit den Menschen seiner Geschichte aber werden erdrückt von McKays belehrend anmutendem Sarkasmus und Faible für Kostüm- und Perücken-Ulk.
Alleine mit Christian Bale (Hostiles), Amy Adams (Arrival) und Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) bietet der Film drei Schauspieler, die sich alle in jeweils unterschiedlichen Filmen wähnen. Rockwell spielt George W. Bush schön doof und mit falscher Nase, als absurde Comicstrip-Karikatur. Adams scheint verwirrt, wie ernst der Film sie und ihre Rolle nimmt, spielt ein unentschiedenes Hin-und-Her. Und Bale - jeden Satz zwischen verzogenen Lippen hervorröchelnd, gedanklich scheinbar schon bei der Oscar-Dankesrede – nimmt das alles, vor allem aber sich selbst, ganz schrecklich ernst. Am Ende scheint nur Komponist Nicholas Britell (Moonlight) wirklich verstanden zu haben, für welchen - in der Theorie vermutlich reizvollen - Film er engagiert wurde. Britells tragische und dabei stets von einer erschütternden Abgründigkeit erfüllte Musik ist absolut meisterhaft und haucht dem Film unverdientes Leben ein.
„How the fuck did this happen?” Eine Antwort auf diese Frage hat McKay am Ende nicht. Stattdessen begnügt er sich mit der selbstgerechten Feststellung, dass das amüsierte Publikum Mitschuld trägt. Der menschliche Rahmen in Vice - ein Nachfühlen menschlicher Bosheit, Zurückverfolgen fataler Entscheidungen, Psychogramm rund um das vergiftete Herz Dick Cheneys (eine Metapher, die der Film am Ende selbst bemüht) - bleibt immer nur Behauptung. Stattdessen fühlt sich Vice wie ein Film an, der dieser Frage eigentlich gar nicht auf der Spur ist. Sondern lediglich Interesse an ihr bekundet, um dann allerlei blöden Witzen zu frönen. Zu Überschneidungen mit dem tagesaktuellen politischen Diskurs hat McKay dann ganz zum Schluss, in der Mid-Credit-Scene, auch nur noch eine Plattitüde zu erzählen, mit der sich der Film so treffend selbst zusammenfasst, dass man ihn in seiner radikalen Doofheit fast schon konsequent nennen möchte.
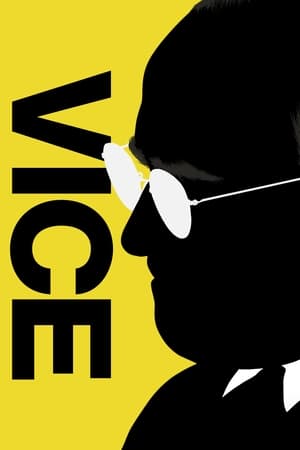 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org