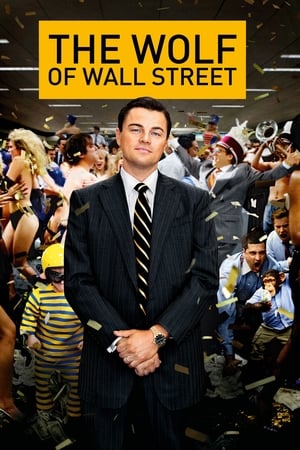„White elephants – the God of Hollywood wanted white elephants, and white elephants he got” – mit diesen Worten eröffnet Avant-Garde Filmemacher Kenneth Anger seine Bibel unter den Traumfabrik Enthüllungsbüchern „Hollywood Babylon“ und beschreibt zu Beginn den gigantischen Aufwand hinter der Kreation von „Belshazzar’s Feast,“ der Kulisse von D.W. Griffiths Film Intoleranz, welche nach Anger, für den der Regisseur in der Pre-Code Stummfilmepoche der 10er bis 20er Jahre noch ein Gott war, Griffiths Vision von der sündhaften Stadt Babylon darstellte, eine Metapher für Los Angeles, welche von damals bis heute mehrfach umgewandelt wurde, aber dennoch ungebrochen bleibt. Auf den Spuren dieses Bildes von der Traumfabrik geboren aus den Höllenfeuern, aber auch auf den Interpretationen jener Spuren von Anger und Griffith basierend, wandelt fast hundert Jahre später ein Jazz-Fan namens Damien Chazelle (Whiplash, First Man), welcher, nachdem er Hollywood mit La La Land gehuldigt und es erobert hatte, diesen Mythos nun exzessiv in seinem 189-Minuten Epos Babylon zerstören muss. Genau wie Anger beginnt Chazelle mit einem Elefanten, welcher, statt die Säulen des Paradieses zu zieren, genüsslich in der Eröffnungsszene auf die Linse der Kamera scheißen darf. Schon von hier an beginnt sich Babylon als das Werk eines verkappten Edgelords zu enthüllen, der das alte Hollywood genüsslich seinen Fanboy-Träumen nach zurechtrückt. Aber es ist auch ein Film, der fulminant beweist, dass gerade so ein verklärender Ansatz nicht der schlechteste ist, wenn es um eine Stadt geht, deren Mythos immer größer sein wird als jede Realität.
Besagter Elefant wird schließlich mit Mühe und Not als Attraktion auf das abgelegene Herrenhaus des, an Namen wie Cary Grant oder Douglas Fairbanks angelehnten, HollywoodstarsJack Conrad (Brad Pitt, Fight Club) gebracht. Auf dessen, mitten in der Wüste gelegenen, Anwesen findet gerade die Feier des Jahres 1927, oder für die Verhältnisse der Roaring Twenties eine ganz normale Wochenendparty, statt. Unterlegt von dem tobenden, nicht aufhörenden Jazz-Score von Chazelle Veteran Justin Hurwitz aus Trompeten und Schlagzeugen und einfangen in den schwindelerregenden Kamerafahrten von Linus Sandgren (James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben) wird man Zeuge eines orgiastischen Spektakels in dem sich Berge an Alkohol und Koks ergießen und wo Hollywood-Legenden und Randfiguren genüsslich in den Hinterzimmern auf sich urinieren lassen. In dieser Achterbahnfahrt aus Sinneseindrücken lernen wir schließlich unsere Hauptfiguren kennen, allen voran das noch erfolglose, Clara Bow-esque Starlet Nellie LeRoy (Margot Robbie, The Wolf of Wall Street) und der noch unbedeutendere Set-Runner Manny Torres (Diego Calva, I Promise You Anarchy), welche sich in diesem Tumult gegenseitig finden und sich zugekokst versprechen, sich in der Welt von Tinsel Town zu verewigen.
Wer glaubt, hier sei Babylon bereits auf seinem exzessiven Höhepunkt angelangt, dem belehrt das folgende Segment eines besseren: Am nächsten Tag kreuzen sich die Wege von Jack, Nellie und Manny in Form einer noch kolossaleren Montage erneut auf einem gigantischen Filmset: Jack dreht gerade sein hochbudgiertes Historienepos, Manny muss inzwischen von der Wüste zur Stadt und wieder zurück eilen, um die letzte verfügbare 35mm-Kamera noch vor Einbruch der Dunkelheit ans Set zu bringen und Nellie spielt sich in einem Westernfilm als verführerische Bartänzerin, die sich weder vor Nacktheit noch anderen Obszönitäten schämt, in die Herzen einer Regisseurin und wird gefühlt über Nacht zum Star. Wie nahe Exzess und Kinohandwerk beieinander liegen bekam man wohl selten in solch ausufernder Weise zu spüren.
Chazelles Film lebt von solchen Segmenten, deutlich mehr als er es als filmisches Ganzes tut. Wenn Chaos und Leidenschaft auf der Leinwand herrscht ist Babylon ganz in seinem Element und Chazelle erschafft durch wahnwitzige inszenatorische Einfälle ein umfangreiches Gesamtbild dieser besonderen Zeit vor der Ankunft des Tonfilms. Trotz der langen Laufzeit des Filmes rafft Chazelle, dessen Film selten auf realexistierende Ereignisse oder Persönlichkeiten direkt zurückgreift, dabei diese Welt in minutiöse Details und Nebenfiguren. Ein gutes Beispiel für letzteres ist die verführerische, Anzug tragende Kabarett-Sängerin Lady Fay Zhu (Li Jun Li, Front Cover), die in ihrer ausgestellten Exotik und Queerness wie eine Mischung aus Anna May Wong und Marlene Dietrich wirkt. Auch sie führt ein Leben bei Tag: Sie muss die Zwischentitel für die Stummfilme schreiben. Den wichtigen Einfluss, den der Boulevard-Journalismus und die daraus entstehende Yellow-Press auf das Spektakel haben wird verkörpert von der Journalistin Elinor St. John (Jean Smart, Garden State), die sowohl Nellies Aufstieg zur namenhaften Skandalschauspielerin anfeuert, aber auch Jack, als dieser seine Position in Hollywood irgendwann gegen seine schleichende Irrelevanz im Angesicht des drohenden Tonfilms verteidigen muss, mitteilt, das seine besten Tage wahrscheinlich hinter ihm liegen: „It’s bigger than you“ schleudert sie ihm entgegen und Jack kann dies nur schweigend akzeptieren. Gegen den technologischen Fortschritt wird selbst der größte Leinwandgott zum Winzling. Der Anfang vom Ende hat eingesetzt.
So fulminant dieser Ritt durch Hollywood beginnt, so erwartbar bitter wird er enden. In einer abstrusen und unfassbar lang gestreckten Szene muss Nellie ihren ersten Tonfilm drehen und die Dreharbeiten erweisen sich als katastrophal: Als sie bereits ihren Eröffnungssatz „Hello College!“ imposant ertönt zerfliegen fast alle Lautsprecher und auch sonst geht am Set fast alles schief, was schief gehen kann. Von hier aus sind die Weichen für die Fahrt in den Abgrund für alle Beteiligten gelegt. Den wohl radikalsten Übergang in der Kinogeschichte, von Stumm zu Ton, fängt Chazelle zunächst als riesiges Testament dafür ein, wie Gesten auf der Leinwand ihre Bedeutung verlieren, wenn sie denn verbalisiert werden. Conrad ist ebenso davon betroffen: Ohne Ton war er ein romantischer Gott auf der Leinwand, mit Ton wird sein „I Love you“ zu einer Lachnummer. Ganz im Stile seines (völlig offensichtlichen) großen Bruderfilmes Boogie Nights, in dem Paul Thomas Anderson den Aufstieg und Fall der amerikanischen Pornoindustrie der 70er nachzeichnete, und aus welchem sich einige Segmente nahezu direkt entnommen anfühlen, wird die zweite Hälfte von Babylon zur langsam zum Stehen kommenden, introspektiven Realisation. Doch während PTA, Robert Altman, Federico Fellini und andere Vorbilder selbst mit dem größten Ensemble von Anfang an der Entwicklung ihrer Figuren verschrieben sind, behandelt Chazelle seine Charaktere wie Stellvertreter seiner Idee eines Old Hollywood.
Der Exzess von Babylon, wie auch der anschließende Fall fühlen sich wie eine gigantische Pastiche an, wie eine durchkalkulierte, wenn auch unfassbar immersive, Achterbahnfahrt im Stil der Roaring Twenties und später der großen Depression. Vielleicht trifft Chazelle gerade deswegen den Kern der Traumfabrik: Sein Herz an eine Welt zu verlieren, in der von vornherein nie etwas echt war, kann nur in einer großen Tragödie enden. Wir sollen fasziniert davon sein aber nie gestattet der Film seinen Figuren selbst diese Faszination. Bis auf Manny, dem eigentlichen Kernstück des Filmes, weswegen ihm Chazelle wahrscheinlich auch die blind naive, aber auch grotesk schöne, letzte Szene des Filmes schenkt, sind alle Figuren Egomanen, die nur an ihrem eigenen Erfolg interessiert sind. Der Film selbst teilt diesen Blick: Old Hollywood sind Exzess und Verdorbenheit, für die Liebe zur Kunst ist da kein Platz auf dieser Party. Vielleicht fühlt sich der Auftritt von Tobey Maguire (Der große Gatsby) als Mafiaboss James McKay, der seine Gäste in das „Arschloch von Los Angeles“ führt, deswegen so überwältigend an: In der Präsenz von hoffnungslosen Egomanen ist Chazelle immer noch in seinem Element, die wahrscheinlich größte Linie, die sich durch seine bisherige Karriere zieht. Je größer besagtes Ego, desto gewaltiger die Szene. Für einen Film wie Babylon bedeutet dies, das so gut wie jede Szene zu einem Schmuckstück aus Zelluloid wird. Die Erkenntnis aber, am Ende trotz allem Teil des Fortschritts, der Innovation und der Zukunft gewesen zu sein, fühlt sich undurchdacht an, war es ja gerade jener Fortschritt, der Jack, Nellie und Manny die Karriere kostete. Aber es ergibt Sinn, wenn man es als ein großes „Dankeschön“ für all die Erinnerungen betrachtet, denn von denen liefert Babylon dann doch mehr als genug.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org