Kritik
In goldgelbes Licht getauchte Straßenecken, ausgeblasener Zigarettenrauch, eine im Wind wehende Haarlocke: American Honey ist ein Film der Momentaufnahmen. Unter der Regie von Andrea Arnold (Fish Tank) wird Close-Up an Close-Up gereiht, als hätte die Kamera Angst ihre Protagonisten aus den Augen zu verlieren, wenn sie sich zu weit von ihnen wegbewegt. 164 Minuten lang klebt sie an der jugendlichen Star (Sasha Lane), leistet ihr Gesellschaft beim Müllsammeln, quetscht sich mit ihr in einen stickigen Tourbus, beobachtet sie bei Tanz, Sex, Arbeit und… Leben. Ja, dieser Film bannt das Leben so vereinnahmend und rhythmisch auf die Leinwand wie vermutlich kein anderer dieses Jahr – und erzeugt eine Immersion, die immer dann am stärksten ist, wenn Musik und Bild zu einer perfekten Symbiose verschmelzen.
Dieser bunte, teufelswilde Rausch hat einen kräftigen Herzschlag und wenig Substanz – oder besser gesagt zu wenig, zumindest für die Lauflänge von beinahe drei Stunden. Die vielen repetitiven Elemente der Handlung mögen der Erzeugung eines nachempfindbaren Lebensgefühls dienlich sein, dünnen den Film aber erzählerisch rapide aus. Arnold möchte in ihrem Film vom Leben erzählen, vergisst aber, dass das Leben manchmal nicht filmreif ist – gerade wenn es gefährlich mit der Eskalation flirtet und Konfliktsituationen entwirft, die sich um Mord oder Prostitution drehen, diese aber nicht befriedigend aufzulösen, beziehungsweise auszuerzählen versteht. Zu sagen, dass „hier nichts passieren würde“, wäre unzutreffend, aber der Plot bleibt dennoch ein scheinbar ewiger Kreis wiederkehrender Stationen und Situationen.
In seinem Porträt Amerikas setzt der Film nicht auf Subtilität, sondern konfrontiert den Zuschauer schonungslos mit allen Herden des Übels. Schon die Eröffnungsszene, in der Star mit ihren zwei jüngeren Schützlingen in einem riesigen Müllcontainer nach Essen sucht, gibt den Ton an. Aber auch später kreiert Arnold immer wieder verstörende Momente, die nicht selten auch mit beißender Ironie durchtränkt sind. Kinder, die in zugemüllten, verrotteten Wohnungen leben, weil die Mutter heroinsüchtig ist, schnüren die Kehle zu; religiöse Suburbanhausfrauen, die glauben Star sei vom Teufel besessen, weil sie geflucht hat, laden zum Schmunzeln ein – gerade wenn wir durch eine Glasscheibe beobachten können, wie währenddessen das Wohlstandstöchterchen im Garten Popsongs laufen lässt und sich dazu unter dem Rasensprenger anzüglich räkelt.
Visuell bewegt sich der Film irgendwo zwischen sprödem Realismus und träumerischem Musikvideo mit ganz viel #picoftheday-Ästhetik – das 4:3-Bildformat engt den Spielraum der Protagonisten ähnlich ein wie das gesellschaftliche System, in dem sie zu leben gezwungen sind. Sowieso ist der Film bis zum Bersten mit visuellen Metaphern aufgeladen, die meisten von der dichten Kamera so schmerzhaft offensichtlich in den Fokus gerückt, dass sie dem Inhalt ein thematisches Gewicht auferlegen, das dieser zuweilen einfach nicht zu bieten hat. Immerhin schauspielerisch bleibt der Film durchweg überzeugend mit einer hingebungsvollen Leistung von Skandaljüngelchen Shia Labeouf und einem starken Debüt von Sasha Lane, selbst wenn ihre Figur – wie eigentlich jede in diesem Film – ziemlich unerträglich ist.
 Trailer
Trailer





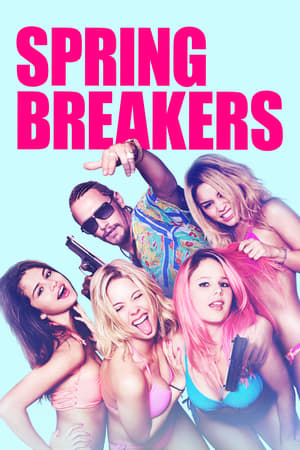
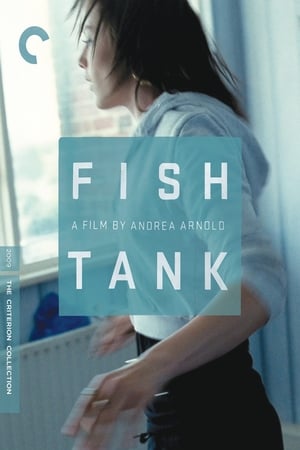
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!