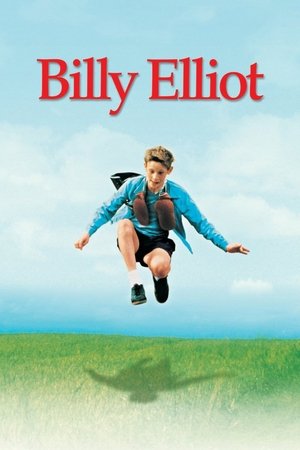Quelle: themoviedb.org


- Start 17.01.2019
- 115 Min DramaBiografieMusik
- Regie
- Drehbuch Paul LavertyCarlos Acosta
- Cast Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez
Inhalt
×