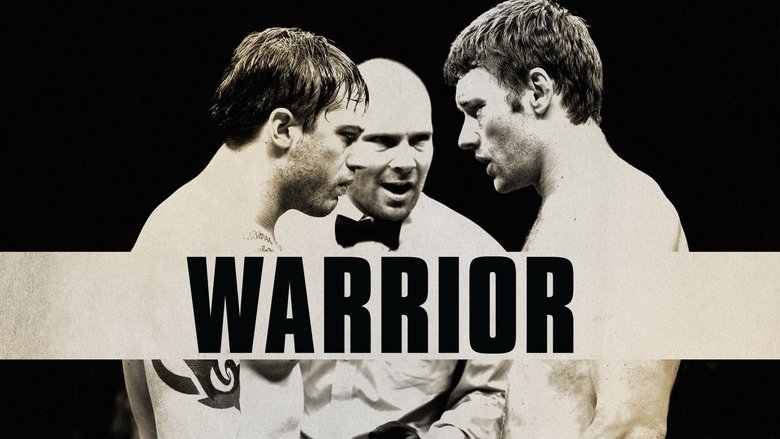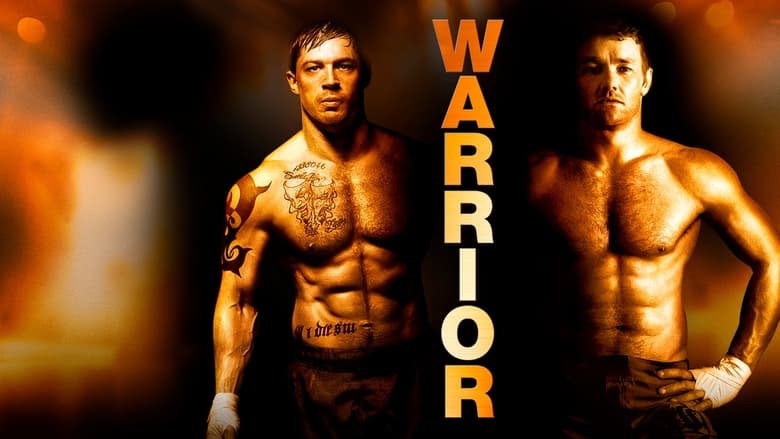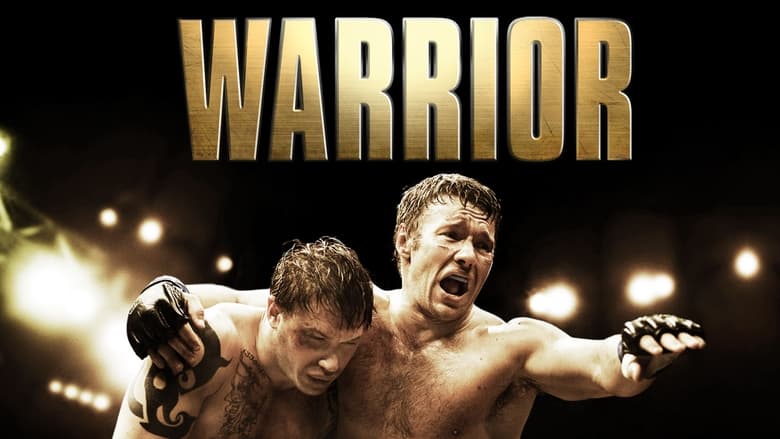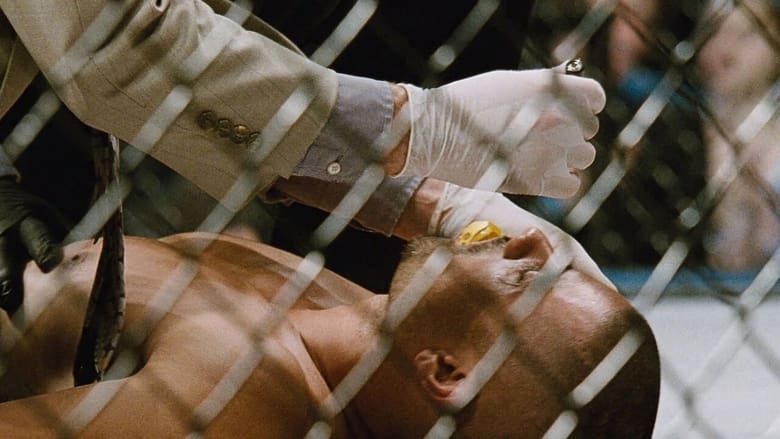Im Jahr 2010 gelang es Regisseur David O. Russell mit The Fighter nicht nur spielend das leicht angestaubte Box-Genre mit neuen Leben auszustatten, sondern auch gleichzeitig einen der besten Filme des Jahres zu produzieren. Die hervorragende wie einfühlsame Milieustudie wurde ein voller Erfolg und konnte sogar bei den Oscarverleihungen 2011 insgesamt zwei der begehrten Statuen abräumen. Kein Wunder, denn das eigentliche Sozialdrama mit Mark Wahlberg und Christian Bale, stand ganz in der Tradition eines Rocky: Eindringliche Kampfszenen wurden gepaart mit persönlichen wie emotionalen Tragödien. Doch das Familiendrama, basierend auf wahren Begebenheiten, war nicht der einzige Film, der mit solchen Qualitäten überzeugen konnte. Etwas im Hintergrund, dafür aber keineswegs schlechter, agierte auch Regisseur Gavin O’Connor mit seinem Bildgewaltigen Warrior. Während jedoch Russell zum Publikums- wie Kritikerliebling avancierte, bleibt O’Connor hier in Deutschland nicht mal mehr der Kinostart gegönnt. Dies ist umso tragischer, da der Film rund um zwei Brüder die Gegeneinander in den Ring steigen, nicht nur perfekte Unterhaltung bietet, sondern auch eine fast schon beängstigend gute Geschichte über Läuterung, Vergebung sowie dem unbedingten Willen zu siegen. Dies zusammen mit den exzellenten Leistungen von Joel Edgerton, Tom Hardy und Nick Nolte, ergibt ein Drama, welches bereits jetzt zu den besten des Jahres zählt.
Warrior lebt hierbei aber nicht nur durchgängig von seiner fantastischen Inszenierung, hier vor allem von den Kämpfen, sondern auch von seiner mehr als eindringlichen wie herzerwärmenden Geschichte über zwei entfremdete Brüder und ihren ehemals Alkoholkranken Vater. Um indes das bestmögliche aus seinen Figuren herauszuholen, lässt sich anfangs Regisseur Gavin O’Connor, der auch das Drehbuch schrieb, eine Menge Zeit. Stets abwechselnd wird mal Tommy als harscher Soldat vorgestellt, mal Brendan als gutbürgerlicher Vater, der unverschuldet in Problemlage geraten ist. Doch auch Paddy bekommt seine Tiefe, in dem er per Hörspiel Herman Melvilles Moby Dick hört und so gleichsam zum besessenen Kapitän Ahab hochstilisiert wird. Sind schließlich durch die ruhige wie intensive Erzählart alle Charaktere platziert, wirken die Bilder umso wuchtiger, vor allem wenn sich die beiden Brüder nach einer knappen Stunde das erste Mal (wieder)begegnen. Allein durch dieses Geschick entsteht eine wahre Sogwirkung, die durch die energievollen Begegnungen noch verstärkt wird. Durch eine passende Musik sowie einen hervorragenden Schnitt, entsteht dann schließlich eine Atmosphäre, derer man sich nicht entziehen kann. Letztlich ist Mitfiebern garantiert, was angesichts eines Brüderkampfes in einem wahren Dilemma mündet.
Das dies durchaus gewollt ist, ist unterdessen zwar schon abzusehen, doch begeht Regisseur Gavin O’Connor nicht den Fehler, die Story vorhersehbar zu gestalten. Wie und wann etwas passiert, das ist gerade angesichts der Unterschiedlichkeit von Tommy und seinem Bruder Brendan nicht eindeutig. Tommy ist eher der schweigsame Einzelkämpfer, dem seine Kriegserlebnisse verfolgen. Er ist eher hart, unnachgiebig, brutal und kämpft in einem schmutzigen Undergroundring, der wahrlich zu ihm passend ist. Brendan dagegen ist Physiklehrer, gutbürgerlich, treuer Familienvater und trainiert in einem Studio in dem Beethoven im Hintergrund läuft und Nietzsche an der Wand hängt. Stärker können Kontraste nicht ausfallen. Letztlich gestaltet sich so auch der finale Kampf, der in einem großen SPARTA-Turnier mit einem Preisgeld von insgesamt 5 Millionen US-Dollar endet. Das Mixed-Martial-Arts wird hierbei ebenso spektakulär in Szene gesetzt, wie die Atmosphäre des Ringes selber. Die Kämpfe sind nah, intensiv, überaus martialisch wie körperlich, überzeugend und unbeschreiblich dramatisch. Gerade das Finale ist so gespickt mit Emotionen, sodass spätestens hier die typische Underground-Story voll zum Tragen kommt und die Tragödien ihre Befreiung erfahren.
Angesichts der gescheiterten Vaterfigur in Form von Paddy, gehören Tommy und Brendan indes zur Generation ohne Väter. Umso bewegender ist es da, wenn sich ihr Vater stets nähern möchte, aber zu jeder Zeit kaltherzig abgewiesen wird. Egal was auch ihr Vater in der Vergangenheit getan haben mag, er sucht die Erlösung in Form der Akzeptanz und der Vergebung. Und gerade Tommy baut eine Wand aus Abweisungen auf, die Paddy förmlich in den Ruin zwingen. Warrior offenbart dabei viel Feingefühl, sodass angesichts brutaler Kämpfe immer wieder die nötige Ruhe in die Geschichte gebracht wird. Doch auch so gibt es an vielen Ecken etwas zu entdecken. So zum Beispiel Brendans eigentliches Problem mit der Bank, die leichtfertig mit dem Begriff Privatinsolvenz umher wirft und ohne Gewissensbisse eine Familie zerstören würde. Oder auch die Vergangenheit des SPARTA-Veranstalters, der ehemals ein erfolgreicher Hedgefonds-Manager war und daher durchaus an der Miesere Mitschuld hat. Moderne versteckte Kritik ist erkennbar, was gerade die eigentlich recht simple Handlung immer wieder gekonnt auf neue Ebenen bringt. So muss Geschichten erzählen aussehen.
Letztlich ist die Handlung bei einem solch dramatischen Ablauf jedoch nur die halbe Miete. Was ebenfalls zählt sind die schauspielerischen Leistungen, die die gebrochenen Figuren gekonnt auf die Leinwand/Bildschirm übertragen. Angesichts des Dreiergespanns Joel Edgerton, Tom Hardy und Nick Nolte, lässt sich jedoch sagen, dass Regisseur Gavin O’Connor mit seinem Cast einen wahren Volltreffer gelandet hat. Gerade Hardy kann durch seine schier unglaubliche körperliche Präsenz punkten. Zu jeder Zeit wirkt seine wuchtige Gestalt so bedrohlich, dass einem Angst und Bange dabei wird, wenn man an The Dark Knight Rises denkt, in dem Hardy als Bösewicht Bane gegen Batman in den Krieg zieht. Hardy ist zu Recht ein aufkommender Stern, von dem noch deutlich mehr in Zukunft zu hören und zu sehen sein wird. Doch auch der Australier Joel Edgerton (The Thing) überzeugt als Newcomer durch sein Wechselspiel aus Vernunft, körperlicher Überlegenheit sowie sensiblen Spiel. Kleines Highlight ist unterdessen jedoch Nick Nolte als trockener Alkoholiker Paddy. Wie einst Mickey Rourke in Darren Aronofskys The Wrestler, gelingt auch Nolte durch seine teils selbstironisch präsentierte Rolle ein Comeback, welches wohl überraschender kaum sein könnte. Sein eindringliches Spiel überzeugt und lässt so einstige Fehltritte schnell in den Hintergrund geraten.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org