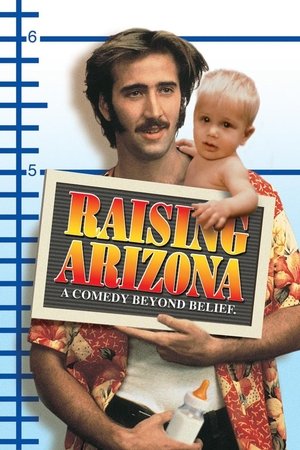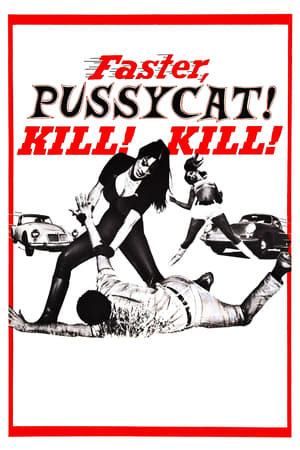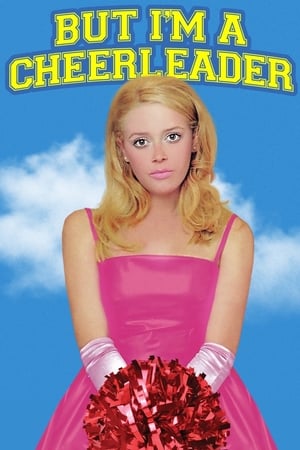In einem Interview mit der Los Angeles Times reflektierte die eine Hälfte des ikonenhaften Regie-Duos Ethan Coen (The Big Lebowski, Fargo) über die vergangene Kollaboration mit seinem Bruder Joel Coen und sein aktuelles Regieprojekt: „Here’s the funny thing: I think 20 years ago, we could have gotten an important lesbian movie made. But this is an unimportant lesbian movie. That just didn‘t compete then”. Was sich als abwertendes Urteil gegenüber seinem eigenen Film anhört, den er zusammen mit Ehefrau Tricia Cooke bereits Ende der 90er verfasste, meint Coen aber voll und ganz positiv: Sein Solo-Debüt Drive-Away Dolls abseits von Bruder Joel sei ein voll und ganz „unwichtiger“ Film und eher zu vergleichen mit einem Drive-In B-Movie der 70er Jahre. Doch bereits mit diesem eher unbeschwerten Ansatz trifft Coen zwei der eklatantesten Schwachpunkte seines Lesbian Road-Movies: Zum einen ist Drive-Away Dolls (der tatsächliche, nicht entschärfte, Filmtitel enthüllt sich erst vor dem Abspann) zunächst ein Musterbeispiel für verblendete Historizität. Der Film soll an das 70er Jahre (S)Expolitation Kino ala Russ Meyer erinnern, spielt aber in den 90ern und hat keine Ambitionen, einer der beiden Zeitebenen gerecht zu werden. Viel eher legt Coen, wohl als subversiver Twist, ein queeres und sexpositives Flair des 21. Jahrhunderts über seinen Film. Was gut gemeint ist verkehrt sich ins Gegenteil und endet in einer Sackgasse, meist durch den Ausdruck zutiefst bemühten Altherren-Humors.
Zum anderen impliziert Coens Aussage, ein harmloser Spaßfilm sei ohne Bruder Joel, der zuletzt mit The Tragedy of Macbeth sich eher weiter in ernsteren Kinofächer einordnet, nicht möglich gewesen, eine Lossagung von beschrittenen Wegen. Gibt man sich den gerade einmal 84 Minuten von Drive-Away Dolls jedoch hin, so stellt man fest das Coen eher dem gemeinsamen Werk seines Bruders hinterher hechelt, statt sich dem abzuwenden. Der Film beginnt zunächst auch passend als Break-Up Movie: Jamie (Margaret Qualley, Once Upon a Time…in Hollywood) hat sich von ihrer Freundin getrennt und schwört der Liebe ab. Zusammen mit ihrer, ebenfalls lesbischen, Mitbewohnerin Marian (Geraldine Viswanathan, Cat Person) soll ein Road Trip ins entfernte Tallahassee und die Besuche in allen möglichen lesbischen Etablissements auf dem Weg sie auf andere Gedanken bringen. Doch sie begegnen der bereits größten, bewährten Coen-Trope: Der Verwechslung. Denn das gemietete Auto enthält einen ominösen Koffer, den eine Reihe von Gangstern, angeführt von The Chief (Colman Domingo, Rustin) gerne zurückhaben wollen. Jamie und Marian geraten in eine Intrige, der Film leider nirgendwo hin. Den Spaßfaktor, den die Chemie zwischen Viswanathan und Qualley, letztere ist hier mit einem Texas-Akzent ausgestattet, der Sandy Cheeks an ihrer kulturellen Identität zweifeln lassen könnte, durchaus hergibt, wird leider immer wieder unterbrochen durch bekannte und eher ermüdende Fettnäpfe zweier Goons, die ihnen auf den Leib geschickt wurden. Coens Film kann sich nie entscheiden, ob er nun dem bunten Treiben zweier frustrierter lesbischen Frauen oder einer Gangsterklamotte bedienen soll und verfehlt schließlich beide Akzente.
Gerade in Sachen Repräsentation non-heteronormativer Sexualität verfährt Coen und Cookes Drehbuch in besagte Sackgasse. Drive-Away Dolls möchte besonders Sex-Positiv sein, oftmals aber kippt die hervorgehobene Promiskuität der Protagonistinnen in einen unangenehmen, prüden Konservatismus. Das etwa Dildos bei Lesben-Sex zum Einsatz kommen scheint Coen für eine so lustige Angelegenheit zu halten, dass er dem mehrere Zotenwitze widmet. Das wirkt im ersten Moment noch unverklemmt, enthüllt sich aber immer mehr als streng heteronormativer Blick. Interessant wird die Dynamik um Jamie und Marian dann erst, als der Film seine Zoten sein lässt und ihnen in einem Hotelzimmer einen Moment enthemmter Zärtlichkeit schenkt. In solchen Momenten wird klar, was ein Film Drive-Away Dolls hätte sein können, nämlich in der Ausarbeitung der Freiheit innerhalb queerer Dynamiken, wofür sich auch die Road-Movie Plotline, welche archetypisch ja von der Befreiung erzählt, eigentlich anbietet.
Bezüglich der anvisierten, am Reißbrett entworfenen Gangster-Klamotte ist jedes Wort zu viel, Coen scheint sie zwar als Dreh- und Angelpunkt zu benutzen, lässt sie aber irgendwann völlig fallen. Das größte Negativbeispiel des Filmes aber, neben seines verklemmten Humors und seiner lieblosen Story, ist fast banal: Die „Scene-Transitions,“ welche meist aus Animationen von umherfahrenden Autos und wehenden Landkarten bestehen und generell so wirken, als hätten sie keinen Platz mehr auf den Monitoren der nächsten Bowling Ally (nicht jedoch der von dem Dude und Walter Sobchak) gefunden. Am Ende muss Ethan Coen die Verrücktheit seines Filmes eben doch erzwingen. Hinter der proklamierten „Unwichtigkeit“ von Coen steht schließlich nichts weiter steht als pure Belanglosigkeit.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org