Eigentlich gibt es viel zu wenige U-Boot-Filme, macht man sich mal gewahr, wie viele Möglichkeiten in diesem unglaublich klaustrophobischen Setting stecken. Natürlich läuft man Gefahr, vorangegangene Werke inhaltlich stark zu wiederholen, aber das schreckt in anderen Fällen ja auch kaum jemanden ab. Die Hürde wurde vermutlich noch größer, nachdem Das Boot im Jahr 1981 zu einem weltweiten Hit wurde und somit die Maßstäbe für dieses subnautische Sub-Genre extrem hoch setzte. Jeder Film musste sich fortan nun damit messen und da macht auch U-571 von Jonathan Mostow (Breakdown) aus dem Jahr 2000 keine Ausnahme, auch wenn dieser Vergleich aufgrund der durchaus unterschiedlichen Ausrichtungen nicht unbedingt fair erscheint. Aber es lässt sich schwer vermeiden.
Im Gegensatz zu dem charakterfokussierten Psychodrama von Wolfgang Petersen will U-571 ein deutlich actionorientierter Kriegsfilm sein, der sich dennoch an wahren Ereignissen orientiert, auch wenn er sie nicht ganz korrekt wiedergibt. Ihm das vorzuwerfen ist dabei nicht zwingend notwendig, denn wie gesagt, das gehört ganz klar nicht zu der Intention des Films. Wer so etwas erhofft, ist eindeutig an der falschen Adresse. Die Enigma, der Codierungsmaschine des Dritten Reichs, deren Sicherstellung im Jahr 1944 (nicht 1942, wie hier dargestellt) einen entscheidenden Beitrag zur Wende im Zweiten Weltkrieg bedeutete, ist im Grunde genommen fast ein MacGuffin. Natürlich nicht ganz im klassischen Sinne, aber letztlich hätte man jeden x-beliebigen Grund finden können, warum sich eine U-Crew an Bord eines gekaperten, allerdings kaum noch manövrierfähigen deutschen U-Boots durch die feindlichen Linien kämpfen muss. Und wenn es nur das eigene Überleben ist. Kann unter Umständen auch mal reichen. Aber das wäre natürlich nicht wichtig und bedeutend genug, schließlich muss hier direkt das Schicksal der freien Welt dranhängen. Das lassen wir mal so hingestellt. Schlussendlich macht die Enigma diesen Survival-Plot natürlich nicht schlechter, erweckt allerdings den Anschein, dass nur so das Überleben der Soldaten von wirklicher Relevanz wäre. Sonst ist man halt verzichtbar und würde sich damit auch mehr oder weniger zweckdienlich abfinden.
Genau das zeigt schon das große Problem auf, dass U-571 tatsächlich hat und wofür dann doch der Vergleich mit Das Boot, aber auch jedem anderen, wirklich guten Kriegs- oder U-Boot-Film im Speziellen herangezogen werden muss. Es ist dieses schablonenhafte, heroisch-verklärte Selbstverständnis, dass für einen guten (US-)Soldat das eigene (Über)Leben nie bedeutsamer ist als die Erfüllung einer wichtigen Mission. Das mag im militärischen Sinne – so schlimm das ist – sogar als korrekt eingestuft werden, trotzdem darf (und muss) ein solcher Film aber doch auch darstellen, dass es da eben eine enorme Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis gibt. Stattdessen impliziert der Film, dass erst durch die extreme Bedeutung der Mission der Überlebenskampf der Männer erst echte Relevanz besitzt. Und so scheinen sie sich auch zu verhalten. Natürlich will niemand von ihnen sterben. Sieht man sie aber hadern mit ihrem Schicksal, verzweifeln an der unmenschlichen Situation? Niemand von ihnen, der mal panisch aus sich herausbricht und herausschreit, warum ausgerechnet er jetzt für die gute Sache droht zu sterben? Nein, so etwas gibt es in U-571 nicht und das soll es vermutlich auch nicht geben, schließlich ist dies in erster Linie ein auf Spannung getrimmtes Unterhaltungsprodukt. Das darf es auch sein, aber diese platte Stereotype der Figuren und die damit implizierter Gleichgültigkeit ihnen gegenüber verhindert massiv, dass ein durchaus kurzweiliger, (überwiegend) gut besetzter und handwerklich mitunter sogar hervorragender Film einen sehr gleichgültigen und letztlich auch enttäuschenden Beigeschmack hinterlässt.
Denn grundsätzlich gibt man sich hier an einigen Stellen richtig Mühe. Die Anfangssequenz, in der der deutsche Zerstörer unter dem Kommando von Kapitän Wassner (Thomas Kretschmann, Indiana Jones und das Rad des Schicksals) selbst schwere Schäden nimmt, ist exzellent inszeniert und vermittelt genau diese Intensität, die ein U-Boot-Film im Idealfall haben kann. Das ist eng, angespannt, voller Adrenalin und vermittelt genau diesen Kampf ums nackte Überleben, der später darauf reduziert wird, dass es wenigstens einer irgendwie schafft. Grundsätzlich hat der Film seine Stärken in der technischen Inszenierung. Für den Tonschnitt gab es seinerzeit sogar einen Oscar, und das völlig berechtigt. Das knackt, rumpelt, ächzt und kracht mit enormer Wucht und verstärkt somit das beklemmende Gefühl, welches einen immer wieder daran erinnert, wie gut dieser Film hätte sein können. Der Cast klingt toll, bleibt aber aufgrund der oberflächlichen Charakterzeichnung überwiegend banal. Der stoische Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) ist hier noch weit entfernt von späteren Glanzleistungen, gestandenen Recken wie Harvey Keitel (The Irishman) und Bill Paxton (Ein einfacher Plan) flankieren nur ohne die Chance glänzen zu können. Und warum Jon Bon Jovi (Das Glücksprinzip) so verhältnismäßig viel Screentime bekommt, ist mit keiner Enigma zu entschlüsseln. Tatsächlich ist es am ehesten Thomas Kretschmann, der durch seine Leistung beeindrucken kann, wenn seine Figur nicht so verschwenderisch selten in der zweiten Hälfte Verwendung finden würde. Sie hat Bedeutung, wird aber nicht entsprechend in Szenen gesetzt. Schade. Da wird viel liegen gelassen, aber unter Strich ist U-571 eben auch kein schlechter Film. Er könnte und müsste vielleicht sogar bedeutend besser sein, da er sich narrativ wie von der Figurenzeichnung selbst limitiert, rein inszenatorisch kann er aber weitestgehend überzeugen. Wohl auch ein Grund, warum Jonathan Mostow danach Terminator 3 – Rebellion der Maschinen gegen die Wand fahren durfte. Was für ein Glück für uns.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

















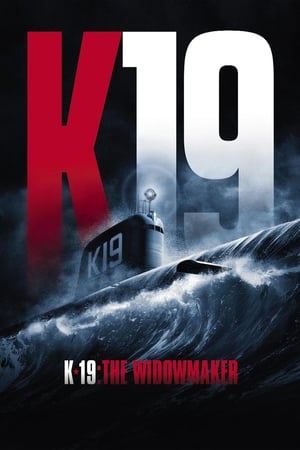

Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!