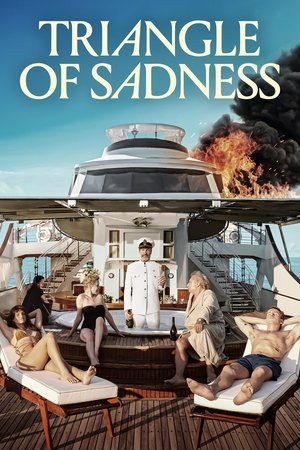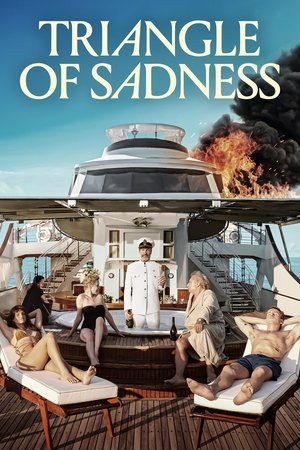Quasi zu seiner Titelverteidigung tritt Ruben Östlund 2022 im Wettbewerb um die goldene Palme von Cannes an, und dem Erfolgsrezept seines preisträchtigen The Square bleibt er dabei durchaus treu. Hatte der schwedische Auteur es in seiner letzten Satire noch auf die Kunstwelt abgesehen, ein gleichermaßen ergiebiges wie—zugegeben—augenfälliges Ziel, so visiert er dieses Mal gleich eine ganze Reihe mehr oder weniger gegenwärtiger Themen wie Vollzeit-Influencer oder die Modeindustrie an, bevor er sich schließlich dem sozialen Problem unserer Zeit annimmt: der sozialen Ungleichheit. In seinen besten Momenten gelingt ihm damit großes Kino, insbesondere, da sich ein Östlund-Film niemals so stilsicher anfühlte wie Triangle of Sadness. Wenn sich Östlunds durchweg unterhaltsamer Neuer dennoch nicht zum ganz großen Wurf aufschwingt, liegt es vor allem daran, dass die stimmigen und geistreichen Beobachtungen immer wieder von Kalauern unterbrochen werden, die einerseits von der Schwierigkeit zeugen, den Witz vom Klamauk zu unterscheiden, und andererseits den durchaus ehrenwerten Ansatz einer tiefergehende Gesellschaftsdiagnose untergraben, den Östlund verfolgt.
Mit unnachahmlicher Verve präsentiert sich Triangle of Sadness indes von der ersten Sekunde an, als wir im Vorfeld eines Modelcastings einen exaltierten Pressevertreter dabei beobachten, wie er die maßgeformten, oberkörperfreien Männern im Wechseltakt anweist, erst einen Balenciaga-Blick aufzusetzen—eine Kombination aus offenem Mund, um „sexuelle Verfügbarkeit zu signalisieren“ und grimmiger, starrer Miene—, um dann, blitzartig, in den H&M-Modus überzugehen—arm aber glücklich. Und wie fühle es sich eigentlich an als männliches Model, nur ein Drittel der Kolleginnen zu verdienen?
Eines dieser Models ist Carl (Harris Dickinson, Beach Rats, The Souvenir: Part II), den wir wenig später in einer denkwürdigen Dinnerszene mit seiner Model-Freundin Yaya, gespielt von Charlbi Dean (Spud), die bereits im Alter von 12 Jahren von einer Modelagentur unter Vertrag genommen wurde. Auf recht clevere Weise lässt uns Östlund zunächst im Glauben, in ihm unsere Bezugsperson gefunden zu haben, als er seine Freundin, die, wie er mehrfach betont, so viel mehr verdiene als er, dafür outcalled, sich durch ihn ein Gratis-Dinner erschleichen zu wollen. Es ist eine Szene, in der Östlund genau jenen Weg einschlägt, den wir im Alltag so oft aufgrund ritualisierter Höflichkeit geschehen lassen. Sichtlich ein Connaisseur der Fremdscham und peinlichen Berührtheit zelebriert Östlund diese Situationen auf unnachahmlich komische Weise, ohne dass seine der Oberfläche verhafteten Charaktere zum bloßen Selbstzweck zur Schau gestellt werden. So verwundert es auch nicht, dass sich die Verhältnisse wenig später umkehren und uns Yaya, die sich eingangs allen voran als zukünftige Trophy-Wife vorstellt, durch einen Moment größter emotionaler Offenheit für sich gewinnt.
Eine emotionale Achterbahn habe er inszenieren wollen, so ließ es Östlund auf der Pressekonferenz verlautbaren, während derer er weiterhin darlegte, dass er mit dieser Komödie die Unterhaltung des amerikanischen Kinos mit dem kritischen Anspruch des europäischen Autorenkinos verbinden wolle. Und tatsächlich gerät seine Satire, sobald seine beiden Protagonist*innen die prunkvolle Suite der Super-Yacht betreten, auf der sie aufgrund ihrer zweifelhaften Strahlkraft als Influencer eingeladen werden, von diesem Zeitpunkt an immer wieder aus dem Ruder. Die grotesk reichen Menschen, mit denen sie gemeinsam in See stechen—ein marktmächtiger Waffenhändler und seiner Ehefrau, ein russischer Ölmagnat, ein von seiner Gespielin verlassener Monopolist der Düngerindustry („I make shit“)—entstammen allesamt einem karikaturesken Einmaleins, und dennoch weiß man sie und die Klischees, für die sie stehen, bei Östlund in guten Händen.
In Woody Harrelson (No Country for Old Men, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) als marxistischer (nicht kommunistischer!) Kapitän findet Östlund indes den wohl dekoriertesten Kollaborateur seiner Karriere, der, sich dauerhaft betrunken in seine Kabine verbarrikadierend, für seinen ersten Auftritt im Film die Zuschauer wie auch seine Board-Crew eine ganze Weile auf sich warten lässt. Als die Dinge, wie es von Beginn an zu erwarten ist, aus den Fugen geraten—als das Schiff immer stärker ins Wanken gerät, ohne dass sich die Gäst*innen an dem zunehmenden Sturm weiter störten; nachdem die Superreichen eine ungeahnte Philanthropie in sich entdecken und nun aus lauter Schuldgefühl das Personal dazu zwingen wollen, sich doch einmal richtig zu amüsieren (und wie ginge das besser als auf einer spritzigen Wasserrutschfahrt in den Ozean?!) und die extrafeinen Gäste angesichts des schwankenden Schiffes die besonders edlen Speisen in erstaunlichen Bögen wieder ausspeien—da ist es dann Harrelsons Kapitän, der durch das Board-Mikrofon aus Noam Chomskys konsumierbaren „How the World Works“ vorliest.
Erzählte man Östlunds Geschichte auf dem Papier, so wäre es schwierig, den Leser*innen verständlich zu machen, was an einer solch handzahmen Kritik an Influencern und Steuermilliardär*innen im Jahr 2022 noch aktuell produktiv aufzubereiten ist. Nicht zuletzt deshalb, da Östlund hier mit einem Grad an Zynismus aufwartet, den man eigentlich glaubte, während der späten 2010er Jahre überwunden zu haben. Denn als Triangle of Sadness im letzten Drittel zu einer Robinsonade übergeht und sich die Hierarchien auf denkbar offensichtliche Weise auf den Kopf stellen und sich die Board-Crew—die Arbeiter*innen—als diejenigen mit nicht nur nützlichen, sondern überlebenswichtigen Fähigkeiten ausgestatteten Gestrandeten herausstellen, während die das oberste eine Prozent repräsentierenden Gäste längst verlernt haben, ihren Alltag ohne die allseits zu Verfügung stehenden Dienstleistungen zu bestreiten, da versucht Östlund gar nicht erst, aus dem Teufelskreis sozialer Klassen und Abhängigkeitsverhältnisse auszubrechen. Die Utopie erscheint, wie so oft dieser Tage, nicht einmal mehr einer Parenthese wert; stattdessen arbeitet sich Östlund an den denkbar offensichtlichsten Zielscheiben ab. Und obgleich sich der diskursive Wert von Triangle of Sadness stark in Grenzen hält, so täte man dem Film doch unrecht, wenn man den streitbar wichtigsten Aspekt eines Filmes außer Acht ließe: das Filmische.
Zum einen ist Östlund mit der Wahl seines Leinwandpaares Harris Dickinson und Charlbi—die Kontakte zur letzteren waren Östlund durch seine Ehefrau, die Fashion-Fotografin Sina Östlund, vermittelt worden (durch jene er auch einst den Begriff des titelgebenden Dreiecks der Traurigkeit aufschnappte—eine Art Vektor auf der Stirn, der sich durch hochgezogene Augenbrauen auf der Stirn einschreibt)—ein Glücksgriff gelungen. Denn wenngleich sich Östlunds Drehbuch insbesondere im ersten Drittel unwahrscheinlich scharf präsentiert, dabei stets treffsicher Situationen sozialen Diskomforts herbeibeschwörend, angesichts seiner beiden vordersten Darsteller*innen, die die schmale Gratwanderung sympathischer Eitelkeit meistern, ist man beinah geneigt zu sagen, dass auch ein weniger raffiniertes Skript durch Dickinson und Charlbi auf beträchtliche Weise aufgewertet worden wäre. Raffiniert zumindest, so lang Östlund sich nicht zu sehr selbst in den eigenen Witzen weidet, die sich ab und an in Erzählschleifen und bemühter Vulgarität verlieren.
Zum anderen beweist sich Östlund hier als Meister darin, auch aus scheinbar Kleinstprämissen noch Pointen zu formen, die der Schwede—trotz ihrer Einfachheit—dank seiner inszenatorischen Selbstgewissheit ins Ikonische zu übertragen weiß, ob derer wir viele dieser Szenen—und sei es nur der Kampf um eine Packung Salzstangen, den Teile der Gestrandeten angesichts der immer knapper werdenden Ressourcen führen—trotz ihrer scheinbaren Banalität in ihren filmischen Qualitäten zu schätzen lernen.
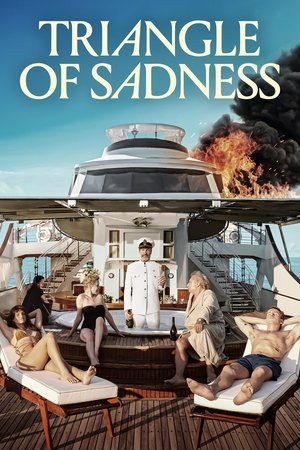 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org