Der Mann aus Virginia, a Neverending Story. Schier unglaublich, in was für einem frühen Stadium der Filmgeschichte bereits etliche Versionen des 1902 veröffentlichten Romans The Virginian von Owen Wister existierten. Nach einer Bühnenadaption zunächst eine 1914 entstandene Stummfilmfassung unter der Regie von Hollywood-Legende Cecil B. DeMille (Die zehn Gebote), auf die bereits 1923 eine zweite Verfilmung von Tom Forman (For Better, For Worse) folgte. 1929 inszenierte Victor Fleming (Vom Winde verweht) die erste Tonfilmfassung des Stoffs, bevor 1946 nun diese Version von Stuart Gilmore (Target) das Licht der Welt erblickte. Vier relativ große Adaptionen zwischen 1914 und 1946 – dagegen wirkt der heutige Remake-Irrsinn ja fast irrelevant. Aber damit nicht genug, denn der Stoff diente auch als Vorlage für die auch hierzulande relativ populäre TV-Serie Die Leute von der Shiloh Ranch, die sich zwischen 1962 und 1971 als erstaunlich langlebig herausstellte. Im neuen Jahrtausend gab es dann noch zwei weitestgehend unbekannte TV-bzw. DTV-Verfilmungen, was das halbe Dutzend allein an Spielfilmversionen vollmacht.
Die Geschichte blieb über die Jahre weitestgehend unverändert. Diesmal spielt Joel McCrea (Mord – Der Auslandskorrespondent) den praktisch namenlosen Cowboy, der in Medicine Bow, Wyoming, des Jahres 1885 überall als der „Virginian“ bekannt ist. Dieser wetteifert mit seinem alten Kumpel Steve (Sonny Tufts, Das verflixte 7. Jahr) noch freundschaftlich-sportlich um die Zuneigung der jungen Lehrerin Molly (Barbara Britton, Ich erschoss Jesse James), die ihr behütet-wohlhabendes Leben (und den schmachtenden Beinah-Verlobten) in Vermont zurückgelassen hat, um sich als starke Frau im Wilden Westen behaupten zu wollen. Mit diesem emanzipatorischen Wunschdenken ist es eigentlich schon direkt nach Ankunft in der rauen Männerwelt vorbei, als sie sich vor einer Kuh erschrickt und sich quasi auf den ersten Blick in ihren tollkühnen Retter aus Virginia verliebt, dieses aber zumindest nicht sofort zugeben mag. Stattdessen wird etwas mit dessen Kollegen Steve angebandelt, aber natürlich lediglich, um sich für den Angebeteten interessanter und unnahbarer zu gestalten.
Genau genommen auch ganz gut so, denn der hat gerade alle Hände voll zu tun. Schließlich treibt eine Bande von Viehdieben in der Gegend ihr Unwesen und der Verdacht fällt sofort auf den zwielichtigen Trampas (Brian Donlevy, Feinde aus dem Nichts) und seine halbseidenen Kumpane. Warum? Na ja, er sieht halt hinterlistig aus und trägt konsequent Schwarz, somit sticht er unübersehbar als Schurke aus den ansonsten sehr farbenfroh gekleideten und für die vermeidlich schroffen Lebensumstände erstaunlich wohlerzogenen und tugendhaften Cowboy-Masse hervor. Leider scheint der gutgläubige Steve - der vom schnellen Geld und einer Reise nach New York träumt – seinen falschen Versprechungen verfallen und bald schon ist Molly nicht der einzige Grund, warum die alten Freunde ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen.
Der Mann aus Virginia ist unverkennbar gekennzeichnet von ganz klassischer US-Wild-West-Romantik. Da sind Männer noch echte Männer, wissen aber noch, was Anstand und Ehre sind und nur die ganz missratenen Gestalten wagen sich über Moral und Gesetz hinwegzusetzen. Zu ihren diabolischsten Zügen gehört es dabei, die leichtgläubigen und von lasterhaften Gedanken wie Reichtum und Frauengeschichten Irritierten zu bezirzen, so dass sich diese von der bösen Seite verführen lassen. Ganz im Sinne tief christlich-religiöser Symbolik und so ertragen die ertappten Sünder auch ohne Murren und Knurren letztendlich ihre gerechte Strafe, denn nur so ist es richtig und aufrichtig. Frauen dürfen gerne so tun, als wären sie modern, weltoffen und stark, aber wenn es darauf ankommt sind sie auch nur hübsch (trotz der vermutlich geringen Möglichkeiten zur professionellen Beauty-Pflege immer top frisiert, geschminkt und in jeder Szene elegant eingekleidet) und zicken nur so lange rum, wie sie das als interessante Eroberung auszeichnet. Schlussendlich erliegen sie dem Charme echter Maskulinität und wenn sie mal dumme Fragen über das alttestamentarische Auge-um-Auge-Prinzip stellen, werden sie mit einem Ehering glücklich und mundtot gemacht. Von echter Ambivalenz keine Spur, schließlich ist man hier entweder von Grund auf gut oder ein durchtriebener Schurke und wer sich wie Steve naiv verleiten lässt, nimmt den Strick beinah noch mit einem artigen Dankeschön hin, schließlich weiß man noch, was sich gehört.
Der Film ist eindeutig ein Kind seiner Zeit und das ist gerade bei US-Western dieser Dekade nicht unbedingt von Vorteil. Handwerklich lässt sich über Der Mann aus Virginia wirklich kein schlechtes Wort verlieren und vermutlich war es zum damaligen Zeitpunkt einfach ein effektiver Crowdpleaser, der den allgemeinen Massengeschmack makellos bediente. Selbst große Klassiker des Genres haben heutzutage mit gewissen Abnutzungserscheinungen zu kämpfen, speziell was das allgemeine Werte-, Geschlechter- und/oder Ethnikbild angeht. Wenn sich hier damit gebrüstet wird, welche Familie beim größeren Indianer-Massaker zu gegen war, ist das sogar gar kein richtiges Problem, denn das ist nun mal eine historisch korrekte Wiedergabe des damaligen Gedankengutes. Weniger korrekt und altbacken-spießig idealisiert ist hingegen natürlich das moralisch-heroische Wunschdenken von einwandfreien Western-Helden in einer noch leicht kantigen, aber an sich schon herrlich zivilisierten wie kultivierten, romantisch-verklärten Wunschgedanken-Welt, die rein gar nichts mit der barbarischen-realen Vergangenheit der eigenen, noch gar nicht so alten Geschichte zu tun hat. Und es gab damals durchaus schon einige Filme, die sich zumindest ansatzweise damit auseinandersetzten, auch wenn natürlich noch nicht im vollen Umfang. Filme wie Faustrecht der Prärie oder Red River sind selbstverständlich genauso Kinder ihrer Zeit und aus heutiger Sicht nicht einwandfrei, sie verlieren sich aber nicht so heillos in dieser bald kindlich-prüden Märchenwelt, die einem im schlimmsten Fall heute übel aufstoßen kann, in diesem speziellen Fall aber eher nur vorkommt wie ein verblichenes Relikt aus Großvater’s Gute Nacht Geschichten.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org










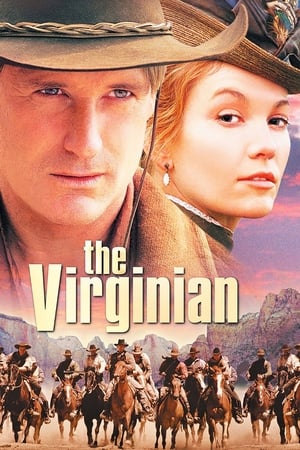


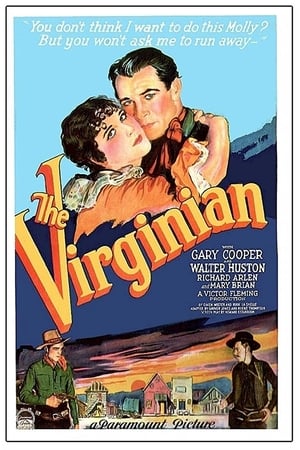
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!