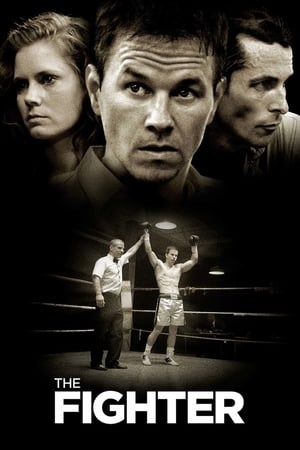Mark Wahlberg hat eine sehr steinige Laufbahn hinter sich. Früher Kleinkrimineller mit etlichen Gefängnisaufenthalten, Anfang der 90er Jahre eine Kurzkarriere als Rapper Marky Mark, dann Unterwäschemodel und schlussendlich Schauspieler. Ein harter Weg, den sich Wahlberg stets erkämpfen musste. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, warum er sich seit Jahren für die Geschichte des Boxers Micky „Irish Ward interessiert, der ebenfalls für seine Träume hart kämpfen musste. Diese packende Story auf die Leinwand zu bringen, war ein langgehegter Wunsch von Wahlberg. Aufgrund fehlender Unterstützung, konnte dieser jedoch lange nicht realisiert werden. Erst durch Regisseur David O. Russell sowie die Hilfe von Schauspielkollege Christian Bale, gelang die Umsetzung in Form von The Fighter. Russell kreiert hierbei ein eindringliches Boxer-Drama, welches sich gegenüber den Klassikern wie John G. Avildsens Rocky oder Martin Scorseses Wie ein wilder Stier keineswegs verstecken muss. Im Gegenteil, dass Leben von Ward und seiner Familie wird so eindringlich präsentiert, sodass eine packende Charakterstudie entstanden ist, die durch die grandiose Schauspielerische Leistung seiner Darsteller noch verstärkt wurde.
Anders als es anmuten mag, liegt der Fokus bei The Fighter keineswegs auf den sportlichen Bereich. Denn in erster Linie ist das Boxer-Drama eine intensive Sozialstudie, die im Bereich des Arbeitermilieus von Lowells Außenseiterbezirken angesiedelt ist. So gibt es keinen Glamour beim Boxkampf, keine heile Welt, nur die intensive wie raue Wirklichkeit. Und wer kann wohl Geschichten besser erzählen als das Leben selbst. Deshalb ist die Handlung von Micky Ward und seinen Kämpfen so authentisch wie es nur sein kann. In fast dokumentarischer Art, erzählt Regisseur David O. Russell eine packende Story über Familie, Bruderliebe sowie den stetigen Kampf gegen die Widrigkeiten des Lebens. Zwar ist der WBU-Weltmeistertitel, den Ward am 11. März 2000 gegen Shea Neary gewann, der unwichtigste in der ganzen Boxwelt, doch was zählt ist der Kampf selber. Diesen gewann Ward durch einen unbeschreiblichen Fight, der den bisher recht unbekannten Boxer zum Weltstar machte. Doch bis dahin war es ein weiter Weg.
Diesen begleitet der Film von seinen dunkelsten Stunden, bis hin zu seinen größten Momenten. Dreh- und Angelpunkt ist hierbei die Familie von Micky. Er hat ständig unter den Bevormundungen dieser zu leiden. Sein Bruder ist abgebrannt, aufgedreht und drogensüchtig, seine Mutter übt ihre Kontrollfantasien aus, ist egoistisch und plant schlechte Fights und seine sieben Schwestern sind ebenfalls keine große Hilfe. Erst durch seine neue Freundin Charlene, die abfällig als MTV-Girl bezeichnet wird da sie ein College-Abschluss hat, findet er auf den richtigen Weg. Die vielen kleinen Streitigkeiten innerhalb des Familientwist wirken dabei nie aufgesetzt oder klischeehaft. Im Gegenteil, durch die grandiose Kameraarbeit von Hoyte Van Hoytema, der immer dicht am Geschehen bleibt, wirkt die Szenerie immer zu Hundertprozent glaubwürdig. So bleibt das gezeigte auch unkommentiert. Bezüglich Dickys Drogensucht beispielsweise, wird keinesfalls der gehobene Zeigefinger angewendet. Der Zuschauer bekommt so einen realen Eindruck von dem, was tatsächlich Anfang der 90er in der Familie Ward geschehen ist. Dies ist ungeschönt, hart und zeigt perfekt das typische Leben in den heruntergekommenen Arbeitervierteln Amerikas. Ebenfalls schafft es Regisseur David O. Russell in der Geschichte immer wieder durch den perfekten Einsatz von Musik, an vielen Stellen emotionale Höhepunkte zu setzen. So wird Dicky beispielsweise von einer HBO-Dokumentation begleitet (diese wurde unter dem Titel High On Crack Street: Lost Lives in Lowell tatsächlich veröffentlicht), die nach Meinung Dickys einen Film über sein geplantes Comeback dreht. Wird dann der wahre Inhalt präsentiert, so ist dies ein ergreifender Moment, indem selbst Dickey sein jahrelanges Handeln vor Augen geführt wird. Solche Tritte in die Magengrube gibt es viele, die auch emotional mitreisen.
Wenn es dann doch in die Boxkämpfe geht, so sind diese wie echte Fights aus den 90ern inszeniert. Die Kamera ist wackelig, das Bild vergilbt und die reißerischen Kommentatoren beschreiben das Geschehen. Die 1:1 Umsetzung der originalen Kämpfe, ist hierbei grandios gelungen. So sind die gezeigten Boxkämpfe zwar kurz, dafür aber intensiv. Die so aufgebaute Atmosphäre, verleiht dem ganzen eine eigene Stimmung, die nur schwer zu beschreiben ist. Mark Wahlberg macht hier eine verdammt gute Figur und ist auch von der Statur her vollkommen glaubwürdig. Besonders der letzte Kampf gegen Alfonso Sanchez, in dem es um den Weltmeistertitel ging, ist durchzogen von Gänsehautmomenten, die zum mit fiebern anregen. Erst hier, fühlt sich dann The Fighter tatsächlich wie ein Boxfilm an. Denn die klassischen Konventionen des Genres, konnte Russell gekonnt Langezeit umgehen.
Während Rocky 1976 noch einen unbekannten Sylvester Stallone offenbarte, ist The Fighter schon mit namhaften Hollywoodstars besetzt, die alle durchweg eine exzellente Leistung abliefern. Allen voran Christian Bale, der für die Rolle des abgehalfterten Dicky wieder einiges auf sich nahm. So ist Bale wieder vollkommen abgemagert und erinnert an seine Rolle in Der Maschinist. Auch ließ er sich die Haare ausdünnen, umso dem echten Dicky noch ein Stückchen näher zu kommen. Und tatsächlich, die Umwandlung ist perfekt. So spielt Bale nicht einfach nur die Rolle des Dicky, sondern er ist es. Stets etwas nervös, aufgedreht, aber dennoch voller Energie und Leidenschaft. Verdient bekam Bale für seine Leistung den Oscar. Normalerweise würde Bale bei solch einer Leistung alle anderen Darsteller mit Leichtigkeit überstrahlen. Doch Regisseur David O. Russell schafft es gekonnt, jeden der Figuren seinen eigenen Freiraum zu lassen, so dass sich die vielen hervorragenden Leistungen zu einem brillanten Gesamtbild ergänzen. Mark Wahlberg spielt die Rolle des Mickey heroisch, energievoll und teils etwas unsicher. Eben genauso, wie man es für einen angehenden Boxchampion mit zweifeln gehört. Familie scheint ihm wichtiger als Karriere zu sein und so will er diese auch stets um sich haben, egal was passiert. Hinzukommt die physische Präsenz von Wahlberg. Schon seit Jahren trainierte er für die Rolle und dieses hat sich wahrlich gelohnt.
Doch nicht nur die Hauptdarsteller machen eine gute Figur, sondern auch die vielen Nebendarsteller. Melissa Leo verwandelt sich mit Bravur in die Mutter der beiden Brüder und spielt ihren Part ebenfalls grandios. Auch hier ist der Oscar vollends verdient. Wenn auch Amy Adams als Mickeys Freundin Charlene noch ein wenig authentischer wirkt. Besonders die Chemie zwischen ihr und Wahlberg stimmt zu jeder Zeit. Mickey O’Keefe, der der echte Trainer von Micky Irish Ward war, spielt sich selber, was zusätzlich für eine passende Atmosphäre sorgt.
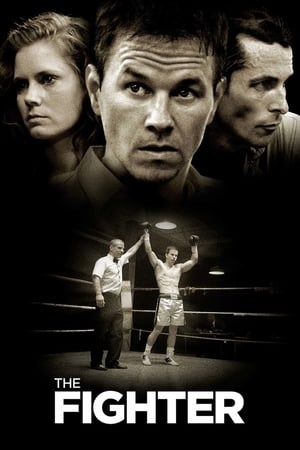 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org