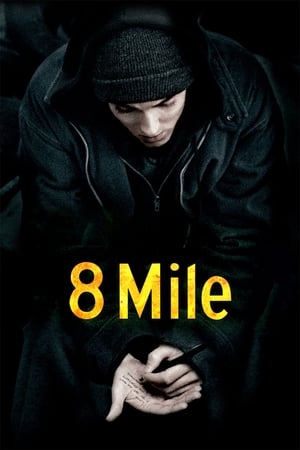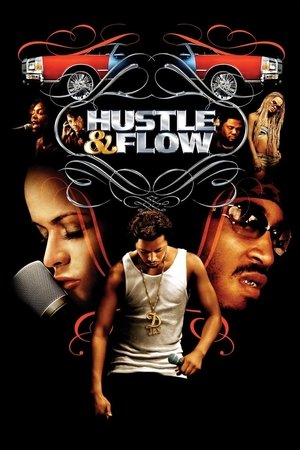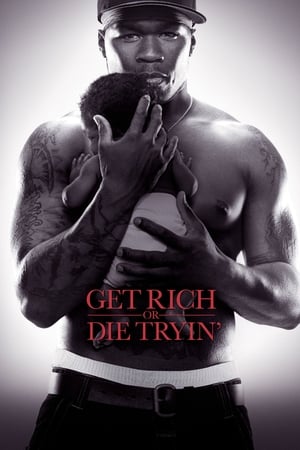Packt eure Kinder an den Händen und lasst sie nicht mehr los, denn es wird gefährlich! – Nach jüngsten Schießereien in US-amerikanischen Kinosälen wurden Medienberichten zufolge die Sicherheitsvorkehrungen bei Vorführungen von „Straight Outta Compton“ verschärft. Geht man also davon aus, dass das Biopic über die stilsetzende fünfköpfige Hip Hop Truppe N.W.A. ein entsprechendes Klientel anziehen wird oder betreibt man nur geschicktes Marketing? Der Film bleibt, soviel sei an dieser Stelle verraten, aber erstaunlich zurückhaltend. Hier wurden keine Risiken eingegangen.
Dre, beam mich weg. Steigen wir also in die Zeitmaschine und lassen uns an die amerikanische Westküste der späten 1980er Jahre bringen. Keine schöne Zeit, ist man schwarz und lebt in einem sozialen Brennpunkt. Compton ist so einer. Die Stadt im Einzugsgebiet von L.A. gilt als Brutstädte für den Hip Hop der Westküste, eine Band hat da im Besonderen ihre Sneakerabdrücke hinterlassen. No Whites Allowed rätselt Jerry Heller (Paul Giamatti) bei der ersten Begegnung mit Eric „Easy-E“ Wright (Jason Mitchell), der gerade mit vier anderen die erste Single in Eigenproduktion herausgebracht hat. Tatsächlich steht N.W.A. für Niggaz wit‘ Attitude und aus dem ersten Treffen zwischen Heller und Eazy-E sollte ein fruchtbares Geschäftsverhältnis werden, aus dem zwei Alben, besonders das Debut Straight Outta Compton resultierten.
In klassischer Biopic-Manier werden uns chronologisch die Ereignisse dargeboten, zumindest das, was die Macher für relevant halten. Die fünf jungen, bisher maximal in der örtlichen Clubszene bekannten Musiker nehmen unter leichten Reiberein ihr Debut auf und füllen damit Hallen mit weißen Teenagern in Houston/Texas. Woher die Musiker stammen und wie ihr familiärer Hintergrund aussieht wird hier leider nur angeschnitten. Es erscheint, als seien alle fünf vom Himmel gefallen, in Wahrheit gab es für einige bereits Projekte im Vorfeld von N.W.A. Sei es drum, der Film will ja auch lieber die Geschichte einer Band, ihren kometenhaften Aufstieg, den nicht minder steilen Zerfall und was danach geschah, beleuchten. Hier begeht man aber einen groben Schnitzer, legt man den Fokus auf die drei nach der Zeit von N.W.A. bekannt gebliebenen Gesichter von O’Shea Jackson aka Ice Cube (gespielt von seinem Sohn O’Shea Jackson Jr.), Andre Romelle Young aka Dr. Dre (Corey Hawkings) und den bereits erwähnten Easy-E. Dass die Band nämlich aus fünf Mitgliedern besteht merkt man nur in Aufnahmesessions und auf der Bühne, ansonsten bleiben die Figuren von MC Ren (Aldis Hodge) und DJ Yella (Neil Brown Jr.) erstaunlich untergeordnet.
Ebenfalls untergeordnet bleiben jeglichen weibliche Rollen. Man kann die Geschichte nicht umschreiben und der frühe Tod von Easy-E, der sich mit HIV infizierte und bereits 1995 verstarb ist ein bedeutender Teil des Films und der Historie der Band, die damals kurz vor einer Reunion stand. Doch die Frage nach seiner damals schwangeren Frau, deren gefühlt einziger Auftritt es ist bei der Diagnose in Tränen aus dem Krankenzimmer zu stürmen, bleibt unbeantwortet. Anscheinend ist ihr Schicksal weniger wichtig (beide sind übrigens nicht infiziert und leben noch heute). Man scheint einem gewissen Personenkult zu huldigen der mit einer übermäßig positiven Darstellung mancher Charaktere verbunden ist. Selbstdarstellung gehört definitiv zum Hip Hop, wie er auch zu vielen weiteren Musikgenres gehört, es fehlt hier aber der letzte Biss. Zu weichgespült kommt da vieles rüber, wenn zwar ordentlich gedisst und gebeeft wird, aber echte Vorkommnisse außen vor gelassen werden. Ice Cube nannte da beispielsweise Easy-E in einem seiner Solo-Tracks eine Schwuchtel („Easy-E turned faggot“ Song – No Vaseline von Ice Cube), was in Anbetracht seines späteren Todes natürlich mehr als zynisch ist. Aus Respekt über sein Vermächtnis hat man wohl einige Kanten glattgebügelt, am Ende aber ein zweischneidiges Schwert. Dieses Glattbügeln trifft aber nicht nur auf den verstorbenen zu, sondern wird besonders im Abspann, bei dem die Errungenschaften der einzelnen Bandmitglieder nach N.W.A. gezeigt werden, überaus glorifiziert dargestellt. Dass sich sowohl Ice Cube als auch Dr. Dre in ihrer Vergangenheit nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, ist da schnell vergessen.
Wohingegen alle Beteiligten samt Regisseur F. Gary Gray („The Italien Job“) einen hervorragenden Job geleistet haben, ist die authentische Darstellung der damaligen Situation in den USA, die gar nicht so weit weg von den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit, Ferguson lässt grüßen, liegen. Die Polizei wird durchgehend als Haufen weißer, rassistischer Drecksäcke dargestellt und selbst ein schwarzer Cop scheint Freude an der Demütigung anderer zu finden. Wenn dazu noch Archivaufnahmen und Nachrichtenbeitrage von den Unruhen rund um die Polizeigewalt im Fall Rodney King und der späteren Freilassung der prügelnden Polizisten gezeigt werden, weht das Gefühl, zum Glück wo anders leben zu dürfen, durch den Kinosaal. Ob die Darstellung der Polizei dieser wirklich gerecht wird (spätestens seit „End of Watch“ wissen wir, was für ein Scheiß-Job das ist) sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall trifft sie die Sicht der schwarzen Minderheit, die sich andere Mittel und Wege sucht, gegen die Polizei vorzugehen. Im Falle von N.W.A. stehen Worte über den Taten, im Song „Fuck tha Police“ verdient man sich eines der ersten „Parental Advisory Explicit Lyrics“ Label und geht hart mit den Cops ins Gericht.
Der Film will nicht kontrovers sein wie sein gleichnamiges Vorbild, man begnügt sich lieber mit dem Konventionellen und einer Romantisierung seiner Charaktere. Für die einzigen Schlagzeilen sorgten Ereignisse beim Dreh, so sitzt Produzent Suge Knight seit Januar im Gefängnis, weil er am Set des Films zwei Männer nach einem Streit mit seinem Truck überfuhr, einer starb. Auch im Film nimmt er die Rolle des ungehobelten und brutalen Antagonisten ein.
Ein kleiner Hinweis am Rande: Die ersten Trailer zeigen bereits, dass die deutsche Synchronfassung diesmal besonders hinterher hinkt. Sucht nach einer Vorstellung mit Originalvertonung, wenn Untertitel angeboten werden, nehmt sie dankend an. Denn der im Film gesprochene Slang stellt das leidige Schulenglisch gehörig auf die Probe.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org