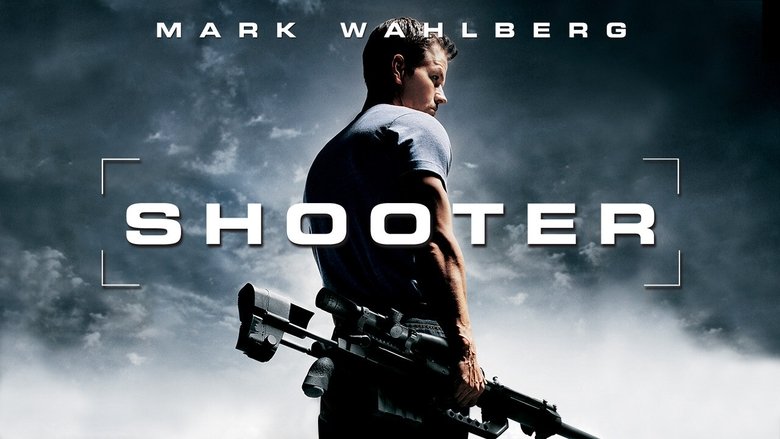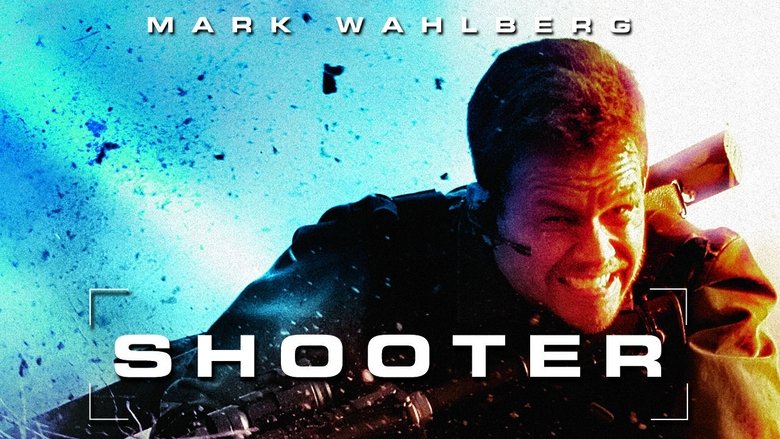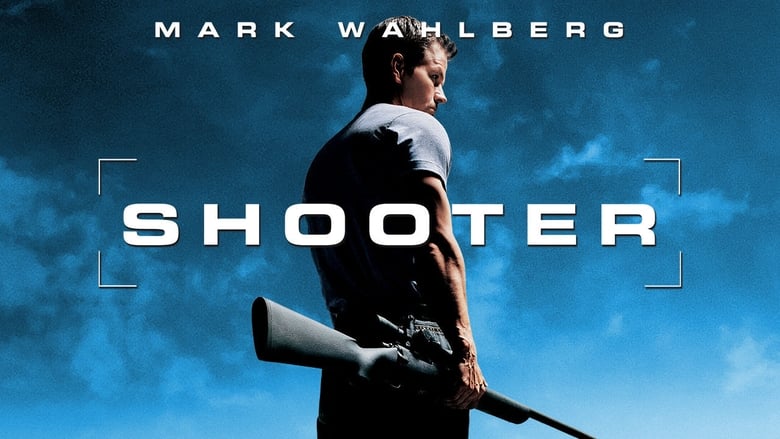Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

- Start 19.04.2007
- 125 Min ActionDramaKrimiThriller USA
- Regie Antoine Fuqua
- Drehbuch Jonathan LemkinStephen Hunter
- Cast Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Jonathan Walker, Louis Ferreira, Tate Donovan, Rade Šerbedžija, A.C. Peterson, Ned Beatty, Lane Garrison, Zak Santiago, Michael-Ann Connor, Shawn Reis
Kritik
Fazit
Kritik: Pascal Reis
Beliebteste Kritiken
-

Shooter
Ein guter und unterhaltsamer Actionthriller mit Mark Wahlberg! Diese Rolle des Scharfschützen scheint voll auf Wahlberg zugeschnitten zu sein. Man sieht ihn gerne in dieser Rolle des Antihelden und er sollte mehr solche Charaktere spielen. Auch die anderen sind gut besetzt. Vor allem die Rolle von Danny Glover. Dieser zwiel...
Wird geladen...
×