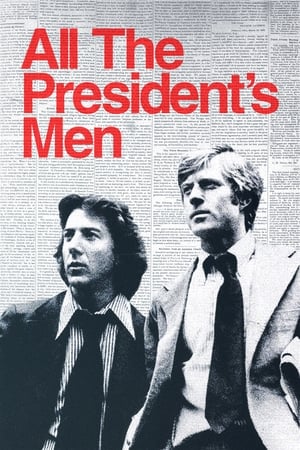Wie nähert man sich einer Geschichte an, in der Nähe nicht das Ziel sich sehnender Intimität beschreibt, sondern vielmehr deren Perversion, deren gewaltsames Aufdrängen? Wie lässt sich eine Geschichte erzählen, die, trotzdem durch Time’s-Up-Kampagne und MeToo-Hashtag längst historisch geworden, vielen von uns noch klar umrissen vor dem geistigen Auge schwebt? Und wie lässt sich eine Geschichte aus der Ungleichförmigkeit mannigfacher Ereignisse und Einzelschicksale formen, die dem Individuum wie auch dem Großen und Ganzen gerecht wird?
Dass Maria Schrader damit anvertraut wurde, diese Geschichte auf Leinwandgröße auszudehnen, überrascht insofern, da sie nun erstmals Teil der Hollywoodmaschinerie wird, ein Aufstieg, zu dem insbesondere ihre Mini-Serie Unorthodox beigetragen haben dürfte, in der sie, lose basierend auf dem gleichnamigen autobiografischen Buch Deborah Feldmans, den Ausstieg einer jungen Frau aus einer orthodoxen Brooklyner Kirchengemeinde nachzeichnete. Die MeToo-Enthüllungen stellen daher durchaus eine gewisse thematische Fortsetzung im Werk Schraders dar, handeln doch beide von der Realität inspirierten Stoffe vom Auflehnen gegen die Misogynie und das Patriarchat.
Allerdings—und es braucht nicht weit mehr als einen Bruchteil der immerhin über zweistündigen Laufzeit, um dies zu bemerken—handelt es sich bei She Said um einen Kompromissfilm, der durchweg kompetent die Recherchen der New-York-Times-Journalistinnen Jodi Kantor (Zoe Kazan, The Big Sick) Megan Twohey (Carey Mulligan, Drive) zum sich zunehmend verdichtenden Missbrauchsskandal in Hollywood bebildert, die sie in ihrem Sachbuch-Bestseller She Said darstellten. Diese fast kühle Souveränität, mit der Schrader ihrem hochentzündlichen Gegenstand begegnet, mag Schraders Ansatz geschuldet sein, die Recherchearbeit der Journalistinnen allem anderen unterzuordnen. Denn auch wenn uns das Cold Open eingangs nahelegt, Schrader würde die Geschichte nun zu personalisieren versuchen — der Film eröffnet in einer irischen Küstenstadt im Jahr 1992 und begleitet eine junge Frau, die, womöglich als Praktikantin oder Assistentin, am Set eines opulent-ausgestatteten historischen Dramas arbeitet, bevor wir sie wenige Augenblicke später, nach einem harten Schnitt, emotional aufgelöst durch die Stadt rennen sehen, augenscheinlich auf der Flucht — der zentrale Schauplatz der Geschichte ist und bleibt über die Laufzeit des Filmes hinweg das ikonische Hauptgebäude der New York Times in Midtown Manhattan, deren Stahl- und Glasfassade, so scheint es, maßgebend für die Tonalität des Filmes Modell gestanden hat.
Schraders Entscheidung für diese unterkühlte Ästhetik spiegelt auf diese Weise das Bemühen wider, die Professionalität der NYT-Redaktion zu würdigen, knüpft indes jedoch gleichermaßen an die Arbeit anderer Filmemachenden an, die in jüngsten Jahren ähnliche Recherchearbeiten ins Zentrum rückten. Zweifellos schießt den meisten Filminteressierten in diesem Zusammenhang Tom McCarthys Spotlight in den Sinn, dessen Drama über die Investigativrecherchen zu den zahlreichen Fällen von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche seinerzeit – und zur Überraschung vieler – bei den Oscars 2016 zum besten Film gekürt wurde. Und auch der französische Berlinale-Dauergast François Ozon, der 2019 in Berlin für Grâce à Dieu den Jury-Preis erhielt und sich mit ähnlichen Vorkommnissen wie Spotlight in Frankreich auseinandersetzte, konzentrierte sich weitgehend auf die Recherchearbeit, wenngleich Ozon in der Reihe der genannten Regisseur*innen am meisten darauf bedacht war, zu dokumentieren, wie seine Figuren sich der Narben bewusst werden, die sie ihr Leben lang zu vergessen suchten, und wie diese Narben nun unaufhörlich weiter aufreißen.
Im Kontrast dazu zeigt sich Schraders She Said weitgehend darum bemüht, den Emotionen so weit wie eben möglich aus dem Weg zu gehen. Vielerorts ist zu hören, dass es sich hierbei womöglich um die bis dato authentischste Darstellung einer solchen Recherchearbeit handelt, und tatsächlich ist man zu keinem Zeitpunkt versucht, dies in Abrede zu stellen. Allein, es will kein Werk entstehen, das weit über die Presseberichte hinausverweist, mit denen viele bereits hinreichend vertraut sind. Die erst kürzlich zur Times gestoßene Jodi, die neben der erfahrenen, schwangeren Megan mit der Investigativrecherche zu den sich häufenden, mal mehr und mal weniger direkten Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein betraut wird, nimmt durch die auch mit Ende 30 noch Jugendlichkeit verströmende Zoe Kazan durchaus für sich ein, letztlich sind Schraders Figuren jedoch wenig mehr als Funktionsträger – Repräsentantinnen eines einstmals idealistischen Berufsstands, der insbesondere mit dem Fortschreiten der Digitalisierung zunehmend an Ansehen verloren und dessen Ethos nun noch einmal in aller Akribie beschworen wird.
Einer bewussten Entscheidung folgend gibt Schrader den Männern, die sinnbildlich für das im Niedergang begriffene System stehen, das strukturelle sexualisierte Gewalt im Arbeitsumfeld ermöglichte, kein Gesicht. Bis zum Ende sehen wir Harvey Weinstein nur hinterrücks, zumeist jedoch tritt jener nur durch das tobsuchtartige Geschrei am Telefon in Erscheinung, das sich immer dann Bahn bricht, wenn die Fortschritte der journalistischen Ermittlungen gegen ihn zu ihm durchsickern. Immer wieder klingelt das Telefon, egal ob im Büro, beim Familienspaziergang oder in der Nacht, und Schrader tut gut daran, uns diese Permanenz spüren zu lassen. Ähnlich verhält es sich mit Donald Trump, der sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 – das Jahr, da der Film einsetzt – mit zahlreichen Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert sieht und im Folgenden telefonisch auf Megan losgeht: „Full of shit“ seien die Journistïnnen und deren „Kampagne“ gegen ihn, darüber hinaus sei sie, Megan, „a disgusting human being“. Nur wenig später krönt Schrader diese Szene noch mit einer Interviewanfrage von FOX News, das ob der durch die NYT veröffentlichten Anschuldigungen gegen Trump von Megan erfahren möchte, ob diese denn Feministin sei – ganz so, als würde eine Bejahung dieser Frage die Berichte über Trumps kolportierte Fehlverhalten delegitimieren.
Es ist ein bezeichnendes Dilemma, das uns Schrader hier präsentiert: Die Geschichte ist ansprechend und sorgfältig aufbereitet, führt uns aus, wie das System Weinstein und dessen Methoden der Erpressung, Nötigung und des Missbrauch beim einstigen Prestige-Studio Miramax einen solch langen Zeitraum unangetastet bleiben konnte und ist überdies kompetent inszeniert. Gleichzeitig hat Schrader mit She Said zweifelsohne ihren konventionellsten Film gedreht, dem zu keinem Zeitpunkt zu widersprechen ist und der sich vielleicht genau deshalb so leer anfühlt. Man mag Schrader zu diesem distanzierten Ansatz gratulieren, zu der Multiperspektivität, die sich entfaltet durch die diversen Hintergrundgeschichten der Opfer, die einst unter Weinstein und dessen Mitwisserschaft litten und denen durch die erfahrene Gewalt Karrieren und Existenzen zerstört wurden.
Indes mutet es allerdings schon seltsam an, dass ein Ereignis von solcher Tragweite, wie es die MeToo-Bewegung war und ist, hier auf so disruptionslose Weise eingefangen wird. Weder auf inszenatorischer, noch auf narrativer Ebene drückt sich die gesellschaftspolitische Dimension der Fälle in einer Form aus, die das ihr zugrundeliegende Sujet transzendiert. Stattdessen macht sich in diesem – und dies ist Schrader wirklich zugutezuhalten – niemals langweiligen Drama eine gewisse Einförmigkeit breit, die wie das Resultat eines übergroßen Writers’ Room daherkommt, in dem alle Vorschläge mehrmals überdacht und schließlich gemeinsam in Form gegossen wurden. Schrader, die mit der lüsternen Literaturverfilmung Liebesleben einst ein gewagtes Regiedebüt ablieferte, erscheint in diesem von Brad Pitt mitproduzierten Recherchedrama ihrer Stimme verlustig gegangen, was angesichts des Titels durchaus ironisch anmutet.
In einer Szene deutet sich an, was eine ambitioniertere Version von She Said zu leisten im Stande gewesen wäre. Damit beauftragt, ehemalige Opfer Weinsteins, die, nachdem sie sich außergerichtlich mit diesem einigten, von der Bildfläche verschwanden, reist Jodi Kantor nach London, Irland und ins Silicon Valley, wo sie schließlich nicht die einstige Schauspielerin, sondern ihren Ehemann in der Einfahrt vorfindet. Als sie dem Ehemann andeutungsweise eröffnet, dass seine Frau einst womöglich Opfer sexueller Gewalt geworden sein könnte, entgegnet dieser aufgebracht: „Sehe ich aus wie ein Mann, dessen Frau viktimisiert wurde?“ In diesem Moment deutet Schrader über das ihr angetragene Thema hinaus auf eine komplexe sozialpsychologische Verflechtung; etwas Größeres, das sie später, womöglich einem übergroßen Pflichtgefühl geschuldet, kaum weiter versucht zu erforschen.
Ebenso andeutungsweise bleibt der beinah im Vorbeigehen geäußerte Vorwurf Rose McGowans, die die MeToo-Bewegung entscheidend mit in Gang setzte und die am Telefon anmerkt, dass ihre Vorwürfe alles andere als neu seien; dass sie diese Jahre zuvor bereits der NYT auseinandergesetzt habe, damals jedoch seien ihre Aussagen auf weitaus weniger offene Ohren gestoßen. Auch hier scheint das Drehbuch weniger einen Punkt zu umkreisen, als ihn abzuhaken, sodass jener nicht gegen das Autorinnen-Team verwendet werden könne. Stattdessen jedoch verfolgt Schrader bis zum Schluss, wenn wir Weinstein mit seiner Entourage an Anwälten im NYT-Hauptgebäude einmarschieren sehen und die tragischen (wenn auch überstilisierten) Worte Laura Maddens hören – jene Frau, die wir eingangs, in der Rückblende ins Jahr 1992, emotional aufgelöst vom Filmset fliehen sahen –, die Jodi an der Küste Cornwalls erzählt, dass ihr durch jene Vorfälle bei Miramax die Stimme genommen worden sei, just in dem Moment, da sie im Begriff war, diese zu finden. Auf seltsame Weise schließt Maria Schrader hier die Klappe zu, ganz, als sei diese Geschichte nun zu Ende erzählt, als sei mit dem Prozess eines Mannes dem System der Garaus gemacht. Spätestens dann erinnern wir uns daran, dass wir uns immer noch in einem Film befinden.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org