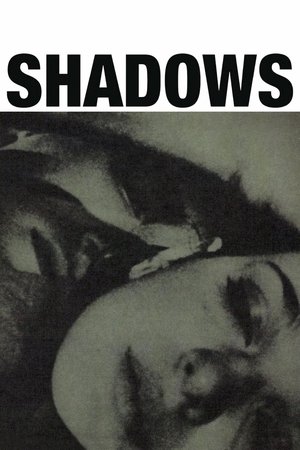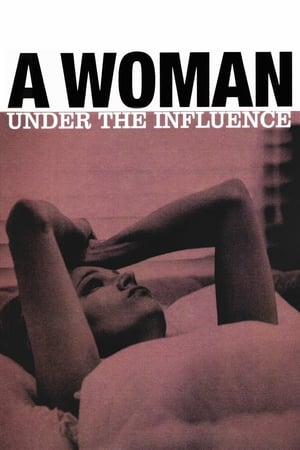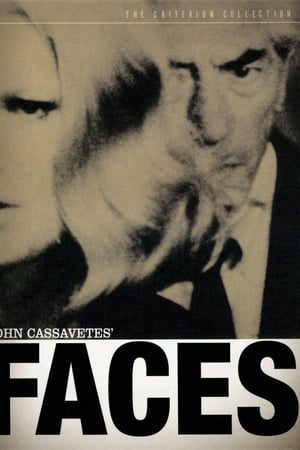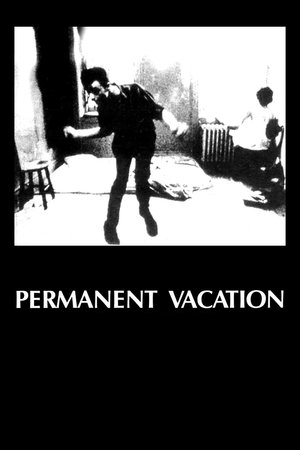Als ein Werk, das völlig für sich steht und isoliert betrachtet wird, vereint Schatten von John Cassavetes (Ehemänner) sämtliche Kennzeichen eines Debütfilms in sich. Die Idee zu dem gerade einmal rund 40 000 Dollar teuren Streifen kam dem damaligen Schauspieler während eines Kurses, den er für einige Nachwuchsschauspieler veranstaltete. Bei den Proben für eine bestimmte Szene traf Cassavetes die im Raum entstehende Energie wie ein Blitz, der ihn nicht mehr verlassen wollte, und animierte ihn dazu, mit geringen finanziellen Mitteln, notdürftig gesammelter Technik sowie völlig unabhängig einen Film zu drehen, der genau diese Energie einfangen und widerspiegeln sollte.
Als Resultat dieses aus der Spontanität geborenen Impulses strahlt Schatten eine ungezwungene, experimentierfreudige Form des Filmemachens aus, bei der die Inszenierung einige unbestreitbare Mängel offenbart, während der Blick des Zuschauers nichtsdestotrotz stets auf die szenenübergreifenden Stimmungen und detaillierten Gefühlsausbrüche gelenkt wird. Auf eine simpel zu durchschauende sowie nach klassischer Dramaturgie gestaltete Handlung verzichtet der Regisseur dabei ganz bewusst. Cassavetes gibt sich in seinem Debüt stattdessen als neugieriger Beobachter, der genauso nach aussagekräftigen Emotionen in den Gesichtern seiner Schauspieler forscht wie er geradezu nebensächliche, augenscheinlich unbedeutende Momente festhält, um beide Strömungen des inneren Umfelds der Charaktere und des äußeren Umfelds der Drehorte ineinander zu verweben.
Im Mittelpunkt der Ereignisse widmet sich der Regisseur drei Geschwistern, die sich recht ziellos und mitunter ohne erkennbaren Erfolg durch die Jazz-Szene des New Yorks der 50er Jahre treiben lassen. Während die beiden Brüder Hugh und Ben Karrieren als Jazz-Musiker anstreben, ist ihre Schwester Lelia eine aufstrebende Autorin, die in erster Linie durch ihr durchwachsenes Liebesleben definiert wird. Bei seinen Figuren setzt der Regisseur auf eine rudimentäre Charakterisierung, so dass sich viele zwischenmenschliche Zusammenhänge nur nach und nach erschließen. Ein wesentliches Motiv der Handlung stellt dabei die afroamerikanische Herkunft der drei Geschwister dar, die nur anhand von Hughs Hautfarbe klar zu erkennen ist, während Ben und Lelia problemlos als Weiße durchgehen könnten.
Cassavetes nutzt diesen Umstand nicht nur für die womöglich intensivste, beste Szene des Films, sondern lässt den eher im Hintergrund mitschwingenden Konflikt zwischen unterschiedlichen Rassen im Zelluloid der Schwarz-Weiß-Aufnahmen verblassen. Die verschiedenen Grauabstufungen des Materials werden hierdurch selbst zum geschickten Kommentar, als wolle der Regisseur alleine durch die Bilder ausdrücken, dass die eigentliche Hautfarbe der Menschen ohnehin keine besondere Rolle spielen sollte. Schatten drängt sich dem Zuschauer allerdings nie als politisches Lehrstück auf, sondern ist weiterhin viel mehr daran interessiert, authentische Lebensnähe sowie ungefilterte Ecken und Kanten zum Ausdruck zu bringen.
In einem Jahrzehnt, in dem das amerikanische Kino zunehmend durch die Erfindung des Fernsehens bedroht wurde und daher hauptsächlich mit opulent ausgestatteten, aufwendig in Szene gesetzten Studiofilmen auf sich aufmerksam machte, kommt Cassavetes‘ Regiedebüt zum Ende der 50er Jahre hin einem deutlich gesetzten Zeichen gleich. Trotz der mitunter unsauberen Schnitte, übereilt abgedrehten Aufnahmen und schlechtem, stellenweise nachsynchronisiertem Ton ist Schatten ein Manifest für die gelebte Momentaufnahme, die Cassavetes mit unerfahrenen Schauspielern heraufbeschwört und in memorablen Szenen untermauert.
Der Moment, in dem Lelia einem Liebhaber, an den sie zuvor ihre Jungfräulichkeit verloren hat, noch im Bett am nächsten Morgen mitteilt, dass sie sich ihm gegenüber doch nur wie eine Fremde fühlt, brennt sich dem Zuschauer ebenso ins Gedächtnis wie die Schlüsselszene des Films, in der sie jenem Liebhaber ihre Brüder vorstellt und dieser überstürzt die Wohnung verlassen will. Der darauffolgende Konflikt steht stellvertretend für die Isolation der zentralen Charaktere, die Cassavetes noch in einigen anderen Szenen ergründet, in denen der jazzige Score erklingt und sich wie ein melancholischer Schleier über die Gemüter der Figuren legt.
Erst ganz zum Schluss enthüllt der Regisseur dann noch, dass der Zuschauer eine Improvisation gesehen hat. Es darf darüber spekuliert werden, wie viel von den gedrehten Szenen und den gesprochenen Dialogen wirklich improvisiert wurde, doch selten hat der nachträgliche Eindruck eines ungeplanten, spontan entwickelten Werks rückblickend so authentische, fast schon erschreckend nah am Leben komponierte Erinnerungen entstehen lassen.
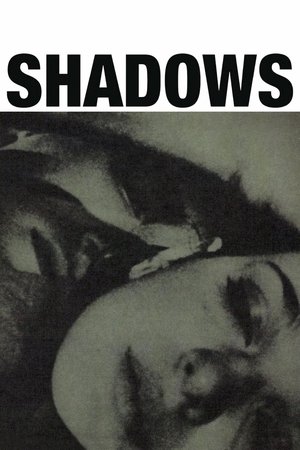 Trailer
Trailer