Gemäß der Mythologie algonkinsprachiger Ethnien ist der Wendingo ein formwandlerisches Wesen, welches zum Symbol der Völlerei heraufgestiegen ist. Dass er dabei nicht wahllos schlingt, sondern eine beunruhigende Präferenz für den Genuss von Menschenfleisch an den Tag legt, ist da keine unbedeutende Information, ging im Raum der amerikanischen Ureinwohner doch permanent die Angst um, in den dichten Wäldern auf einen Wendingo zu treffen, der nicht nur das Ziel verfolgte, einen der Indianer zu verspeisen, sondern auch, ihn höchstselbst zum Wendingo zu konvertieren, in dem er ihn ebenfalls von der heilenden Kraft des Menschenfleisches kosten lässt. Nichtig zu erwähnen, dass sich dabei nur um ein schauriges Volksmärchen, mit dem wohl eher den Kleinen einen Schauer über den Rücken jagen kann, als Grundlage eines schnittigen Genre-Werkes allerdings ist dieses gefräßige Mär allerdings keineswegs gegenstandslos, sondern mehr als geeignet, um das filmhistorische Kannibalismus-Motiv um eine weitere, prinzipiell nicht uninteressante Facette aufzuschlagen. Mit „Ravenous – Friss oder stirb“ wurde genau das bewerkstelligt.
Dass Kannibalismus auch immer für einen Kampf mit seinem Inneren steht, dem Kampf mit seiner Herkunft, seiner Sozialisation und der Destruktion jedweder zivilisatorischer Ordnung, ist „Ravenous – Friss oder stirb“ absolut geläufig. Regisseurin Antonia Bird und Drehbuchautor Ted Griffin bedienen sich in erster Linie aber an der indianischen Mythologie, um ein nebulöses Szenario zu kreieren, in dem gerade Captain John Boyd (Guy Pearce) den Schrecken des mexikanisch-amerikanischen Krieges wie ein erdrückendes Kreuz auf dem Rücken mit sich herumschleppt. Gefeiert von seinen Kameraden, weil er das Lager des Gegners quasi im Alleingang in seinen Besitz nehmen konnte, wird er kurze Zeit darauf in ein Fort in der Sierra Nevada, einer anmutigen Gebirgskette in Mexiko, strafversetzt. Grund dafür war, dass er das Lager nicht durch puren Heldenmut eroberte, sondern sich tot stellte und damit in Kauf genommen hat, dass seine Einheit gnadenlos abgeschlachtet wird. Wie Guy Pearce die resistente Marter seiner Figur greifbar macht, ist wunderbar, allein seine müden Augen sprechen Bände.
„Ravenous – Friss oder stirb“ ist durchzogen von herausragenden Sequenzen, die gerne nur in der Ellipse eines Schnittes aufflackern: Wenn John Boyd in seinem Täuschungsmanöver beispielsweise in einem Leichenhaufen verharrt und das Blut der toten Soldaten sein Gesicht herabläuft, ist das ein eindringlicher Moment, der sich ohne Frage in das Gedächtnis einbrennen wird. Schnell wird den Zuschauer dann wieder bewusst gemacht, warum sich dieser John Boyd so angewidert von Fleisch zeigt, sich gar übergeben muss, wenn ihm ein blutiges Steak auf den Teller geklatscht wird. Und hier entspinnt sich ein interessanter Antagonismus: John Boyd ist unlängst vom Fleisch abgestoßen, zeigt sich eher der Kohlsuppe wohlgesinnt, mit der Einführung des Fremden F.W. Colqhoun (Robert Carlyle) trifft er auf sein Kehrbild, eine Person, die durch eine schockierende Notlage nicht mehr vom Fleisch loszueisen ist und ganze Menschen bis auf das Skelett abgenagt hat. Auch Colqhoun, ebenfalls ein Yankee, wie sich noch herausstellen wird, ist bereit dazu, falsche Fährten zu legen, um an sein Ziel zu gelangen.
Die Hybridisierung von (Nordstaaten-)Western, Survival-Horror und zynischer Humoreske hätte schnell in ein tonales Ungleichgewicht umschlagen und „Ravenous – Friss oder stirb“ zum losen Flickenteppich verdammen können, der zwar gute Ideen besitzt, diese aber zu keiner Zeit unter einen Hut bekommen vermag. Antonia Bird aber setzt in ihrer Inszenierung auf Stimmung und Atmosphäre und ist weit weniger auf einen reißerischen Fluchtpunkt angewiesen, als man es beim Lesen der Synopsis wohl vermutet hätte. „Ravenous – Friss oder stirb“ ist der Kampf zweier Männer, die ihrem Schicksal als Wendingo nicht entrinnen konnten, die sich aber darin differenzieren, inwiefern sie dieser Existenz nun nachgehen wollen oder die Charakterstärke dahingehend festigen, dem Potenz verleihenden Menschenfleisch zu entsagen. Dabei verkommt „Ravenous – Friss oder stirb“ gleichwohl zur nach Genre-Maßstäben ausgerichteten Reflexion über Ethik und den Überlebensdrang respektive Selbsterhaltungstrieb. Auch ein elementarer Aspekt, den Frank Marshall in „Überleben!“ mit Ethan Hawke durch die Ösen gruppendynamischer Reibereien fokussierte.
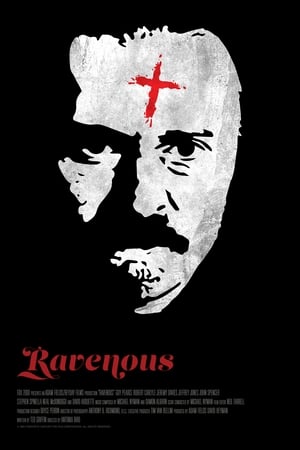 Trailer
Trailer
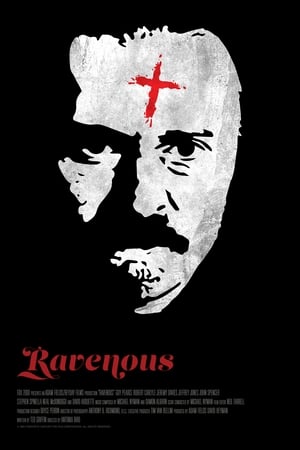

Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!