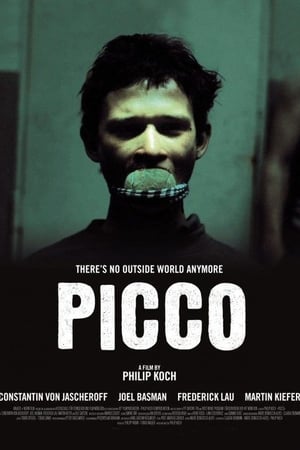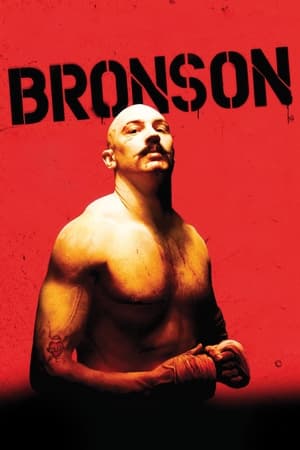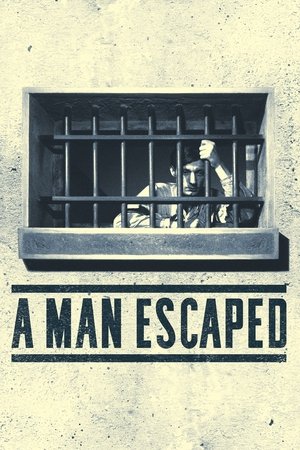Wer erinnert sich nicht gern an das Sommermärchen 2006 in Deutschland? Eine Zeit der Weltoffenheit in Deutschland, des friedlichen Fußballfestes, der blühenden Natur und strahlenden Sonne. Ein jähes Ende fand diese Zeit der Sorglosigkeit spätestens im Herbst, als in der Jugendvollzugsanstalt in Siegburg ein Häftling von seinen drei Zellengenossen gefoltert, vergewaltigt und zum Suizid gedrängt wurde. Die wenigsten Märchen sind harmlos. Aber die meisten Märchen enden mit dem Sieg der Guten. Ist das in Picco auch der Fall? Wer ist denn hier der oder das Gute? Philip Koch (Outside the Box), der mit seinem Film einen Aufschrei beim Max Ophüls-Festival bewirkte und prompt nach Cannes eingeladen wurde, zeigt hier deutlich, dass die Antwort nicht in ein einfaches Ja/Nein-Raster gefügt werden kann.
Als erstes lernt der Zuschauer das Gefängnis kennen. Einen Ort, dem man von außen weder zu Beginn noch in der letzten Einstellung von außen die brodelnde Hitze ansehen kann, die drinnen herrscht und völlig anonym bleibt. Ein von der Außenwelt abgetrennter Bereich, durch den man endlos wandern kann. Von draußen herrscht Stille, drinnen ist es ein Staat im Staate: Es gibt (mehr oder weniger gewählte) Tonangeber, es gibt Mitläufer und Desinteressierte. Jeder weiß von jedem, in welche Kategorie er fällt. Jeder ist Täter oder Opfer - die wenigsten wissen, dass sie eigentlich beides sind. Eine frustrierte, geltungsbedürftige und auf engstem Raum eingepferchte Gruppe Jungkrimineller. Langeweile, Eintönigkeit und Machtgehabe gehören in diesem Männerstall dazu. Dass sich da einiges anstaut und entladen muss, scheint beinahe auf der Hand zu liegen. Die Zeit der Läuterung wird zur Zeit der Frontenverhärtung.
Diese Läuterung wird in Picco unendlich klug inszeniert und quasi zum ersten von zwei bildsprachlichen Schmuckstücken des Werkes. Koch zeigt den Tisch, an dem der Häftling (links, gerade so außerhalb des Bildes) und die Psychologin (rechts, ins Bild vorgelehnt) sitzen. Als der Jugendliche sich vorlehnt, um sich und seine Weltsicht zu verteidigen und nicht von oben herab bemuttert zu werden, zieht sich die Psychologin nach kurzer Zeit zurück. Guter Wille hat seine Grenzen. Am Ende lehnt sich auch der Häftling zurück, niemand sitzt mehr im Bild, und damit nicht mehr am Tisch. Alle haben sich auf ihre jeweilige Seite zurückgezogen, der Dialog ist vorbei, die imaginäre Mauer hochgezogen. Verständnis unmöglich, Trennung unüberbrückbar. Die Menschen sind unsichtbar und damit de facto nicht existent füreinander. So werden Probleme nicht gelöst.
Das zweite bildsprachliche Schmuckstück findet sich in einer Shining-Hommage. Koch folgt Picco (Constantin von Jascheroff, Klassentreffen 1.0) zweimal mit der Steadycam durch die Einrichtung. Einmal durch die endlosen Flure, einmal über den Innenhof beim Joggen. Er folgt Picco dabei mit einem Abstand, der es unmöglich macht, einzugreifen. Der eine Unnahbarkeit und ein Gefühl der Auslieferung bewirkt, die vor allem in dem Kontext des Gefängnisses äußerst beunruhigend ist. Der Zuschauer ist immer eine Armlänge zu weit entfernt, um irgendwas zu ändern. Er (und Picco) können weder etwas gegen das Machtgefüge, noch gegen die Gewalt innerhalb der Zellen und unterhalb des Radars machen. Die Psychologin fragt alle Insassen, ob sie „sich selbst etwas antun wollen“ - als wäre das die größte Gefahr im Gefängnis. Das ist natürlich auch ein anprangernder Aufschrei gegen die JVA-Umstände, der die jungen Kriminellen als schuldige Täter und tragische Gestalten inszeniert. Er entschuldigt dabei nicht die Taten, die die jungen Männer ins Gefängnis gebracht haben, aber zeigt auf, dass eine Verbesserung der Weltsicht so nicht möglich ist.
Deutlich wird das vor allem durch die Rolle von Born to be asso Marc, dargestellt von Frederick Lau (Der Hauptmann), der einmal mehr sehr eindringlich, körperlich und vorlaut spielt. Er dominiert die Viererzelle mit seiner Brutalität, mit seinen Widerworten, mit seinem grundlos destruktiven Verhalten. Über ihn erfahren wir mit am meisten; sein Mutter nimmt Drogen, sein Vater brennt mit irgendeiner durch, er selbst ist mittlerweile ebenfalls Vater geworden. Aber alles, was da draußen passiert, hat keinen Effekt auf ihn. Das lässt er nicht zu, das gönnt er der Welt nicht. Wenn die Veränderungen da draußen nichts mit ihm zu tun haben sollen, dann bitte auch umgekehrt. Koch gibt nicht nur Marc ein problematisches Figurenbild, auch der JVA an sich. Gewalt durch Dritte soll - mehr oder weniger - unterbunden werden. Suizide an sich wären dabei nicht so überraschend. Aber gegen Gewalt und Schlägereien, ui, da muss was getan werden. Weil es die Schuld von der Institution auf das Individuum lenkt. Und die Institution ihre Hände in Reinheit waschen kann. Philip Koch erinnert daran, wie schlecht Blut sich abwaschen lässt.
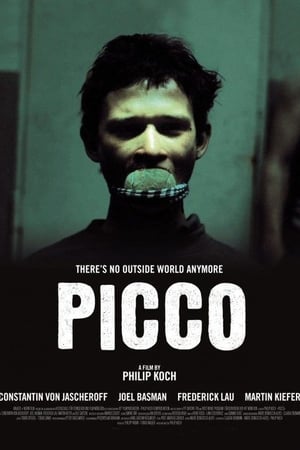 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org