Der Kapitalismus geht in gewisser Form immer mit dem Amerikanischen Traum einher, mit einem stark geprägten Individualismus und dem Drang sich zu profilieren. Die Aussicht, man könne alles erreichen, wenn man sich nur genügend anstrengt oder eine visionäre Idee hat, stellt sich jedoch als Trugschluss heraus. Nicht jeder hat im Kapitalismus die Möglichkeit alles zu erreichen, es muss in diesem System eine Art von Verlierer geben, ansonsten kann es keine Gewinner geben. Man stelle sich eine abendliche Poker-Runde vor, in der Freunde nur zum Spaß einen geringen Beitrag verwetten. Damit nun einer der Freunde mit einem höheren Beitrag aussteigen kann als er eingestiegen ist, muss ein anderer mit einem niedrigeren Beitrag aussteigen als er eingestiegen ist. Es geht im Kapitalismus also ganz stark um Investitionen, darum auf welches Pferd man setzt, welchen Trend man rechtzeitig beobachtet, wem man sein Vertrauen schenkt. Es geht um das Management von Geld, Zeit und Energie.
Und selbst wenn das gelingt, ist es kein Garant dafür, dass man den Weg nach ganz oben schafft, denn die Konkurrenz ist groß. Norman Oppenheimer (Richard Gere, Pretty Woman) gehört zu den unzähligen Menschen, die versuchen ihr Glück in ihrem Erfolg zu finden. Bei Norman erkennt man das besonders stark daran, dass er als einsamer Mann in der Großstadt lebt und vor allem oberflächliche Kontakte pflegt, von denen er sich ein marktstrategisches Potential erhofft. In der ersten Hälfte wird anhand von Norman deutlich, wie ähnlich sich Lobbyismus und Politik sind. Vergleicht man ihn mit Francis Underwood (Kevin Spacey,Baby Driver) aus House of Cards, so fällt auf dass beide versuchen sich ein Netzwerk zu spinnen, mit dem sie sich zum Erfolg hoch kämpfen können. Als Zuschauer hat man jedoch eine ganz andere Bindung zu Norman. Er wird uns als tragischer Charakter kommuniziert, dessen Wünsche wir zu verstehen glauben, während Francis zunehmend als Monstrum erscheint.
Durch dieses ständige Scheitern bei seinen Projekten fühlt man sich an einen anderen Charakter erinnert, an Willy Loman aus Der Tod eines Handlungsreisenden. Autor Arthur Miller kreierte in seinem Buch einen Charakter, der an seinen ständigen Fantasien, seinen ständigen Hoffnungen scheitert. Willy ist ein Opfer des Kapitalismus, weil er von dessen Versprechen hintergangen worden ist. Normans Charakter fällt dabei weniger obligatorisch und dadurch auch weniger subversiv aus, was auch das größte Problem des Filmes ist. Sicherlich ist Regisseur Joseph Cedar (Footnote) eine solide Charakterstudie gelungen, der es aber in der Endkonsequenz an Brisanz fehlt. So bleibt am Ende kein Film über die Beschaffenheit des Kapitalismus, sondern einer über ein Einzelschicksal, das zwar durchaus nicht uninteressant inszeniert ist und wunderbar subtil von Gere dargestellt wird, in sich geschlossen aber eher banal erscheint. Man sucht eben den subversiven Charakter von Der Tod eines Handlungsreisendenund den analytisch faszinierten Charakter von House of Cards vergebens.
Während Francis Underwood von einem derartigen Machttrieb gesteuert ist, dass der eigentlich subjektive Reiz einer Vormachtstellung zu einer eigenen Wissenschaft avanciert und die Serie damit nicht nur das politische System, sondern auch den Kapitalismus aufs Absurde treibt, gelingt das Millers Werk durch das obligatorische Scheitern, das nicht abzuwenden ist, aber auf eine extreme Selbstüberzeugung trifft. Norman sehen wir reden und reden, wir sehen ihn bemüht, wir sehen ihn scheitern und wir sehen ihn gewinnen, aber wir sehen seine Bedeutung nicht. Es fehlt dem Film also an Subversivität, aber auch an Faszination an dem System, unter dem der Protagonist leidet. Das einzig Interessante bleibt also der Protagonist an sich, dessen eigentliche Tragik sich im letzten Drittel immer mehr abzeichnet. Er verstrickt sich letztlich in seinem eigenen Netzwerk, von dem zunehmend andere profitieren, er jedoch nicht. Der erhoffte Erfolg bleibt also aus.
Und dennoch bleibt die eigentliche, auch inhaltliche Aufarbeitung aus. Als Zuschauer bekommt man nicht den Eindruck vermittelt, es handele sich hier um ein strukturelles Versagen, sondern lediglich, dass es sich um einen tragischen Einzelfall handelt. Die Frage, wofür dieser Film und sein Protagonist stehen, kann man am Ende dadurch nicht beantworten. Daran scheitern viele Charakterstudien: Sie arbeiten nicht die eigentliche (oder eine interessante) Faszination des Charakters heraus, was besonders hier sehr schade ist, da die Voraussetzungen perfekt scheinen. Das ständige Einfangen von Telefonaten, die anonyme Großstadt und die kühle Gesprächskultur sind großartige Motive, die aber leider nicht in einen Kontext gesetzt werden, sondern eher wie stille Wegbegleiter erscheinen, die zwar stimmig aber ohne eigene Aussagekraft erscheinen.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org




















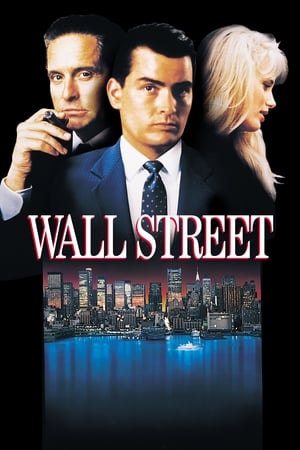

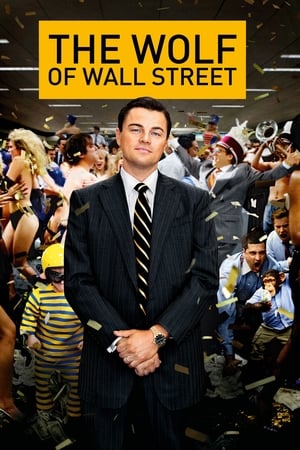

Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!