Dass Glaubensgeschichten trotz derstetigen Dekreszenz der Signifikanz von Religion in der heutigen Gesellschaft auch ein Publikum fernab von fanatischen Verfechtern begeistern kann, bewies Martin Scorsese (Casino) vor zwei Jahren mit dem von Glaubensfragen gespickten und in monumentalen Bildern gefilmten Historiendrama Silence. Doch während Regie-Altmeister Scorsese mit der außergewöhnlichen Reise zweier Jesuiten auf der Suche nach ihrem Mentor ein für das Publikum weitestgehend unbekanntes Gebiet betrat, wagt sich Garth Davis (Lion: Der lange Wegnach Hause) nun mit Maria Magdalena an eine der bekanntesten Erzählungen der Bibel. Die umstrittene Geschichte von einer spirituellen Reise an der Seite Jesu wird hier in 130 Minuten gepresst und nimmt sich nicht nur einigen philosophischen Glaubensfragen an, sondern skizziert die Lasten, die dem Sohn Gottes und seinem Gefolge zu jener Zeit auferlagen.
Die Handlung setzt noch vor dem eigentlichem Start der Reise ein und gibt dem Zuschauer einen Einblick in das Leben der jungen Maria Magdalena (Rooney Mara – A Ghost Story), welches durch die katonische Strenge von dem männlichen Familienoberhaupt reglementiert wird. Doch die junge Maria bleibt unbeugsam und sträubt sich gegen jene dezidierte Lebensweise, die man ihr aufoktroyieren möchte. Ein Umstand, der selbst heutzutage – rund 2000 Jahre später – noch allgegenwärtig ist, wenn auch nicht in solch einem Ausmaß. Als wäre es falsch, an etwas zu glauben, von dem man mit Herz und Seele ohne jeglichen Zweifel überzeugt ist. Marias Glaube wird in ihrem kleinen Dorf derart missverstanden und als unduldsam erachtet, dass man ihr sogar versucht ihre inneren Dämonen durch barbarische Rituale aus dem Leibe zu treiben. Unterdrückung durch sexistische und religiöse Gesellschaftsordnungen bildete den Alltag jener Frauen, wie Maria Magdalena. Nur leider verkommt diese Qual und andere drangsalierende Lasten durch den neuralgischen Ausdruck Maras, der der Figur der Maria Magdalena ein wenig ihre Glaubwürdigkeit nimmt.
Doch durch die Begegnung mit dem Propheten Jesus, dargestellt durch Joaquin Phoenix (Walk the Line) startet ein neues Kapitel ihres Lebens, in dem sie sich der alten Lebensweise entreißen kann und den Pfad der Erkenntnis einleitet. Während Joquin Phoenix als Jesus von Nazareth anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig erscheint und mit seinem Rauschebart und langer Mähne an den benebelten Hippie-Privatschnüffler Larry „Doc“Sportello aus Inherent Vice – Natürliche Mängel erinnert, schafft er es im Verlauf der Pilgerreise ein hinlänglich glaubhaftes Bild des Wanderpredigers aufzuziehen. Spätestens, wenn Jesus dem Tode geweiht mit Blut überzogen und der Dornenkrone auf dem Haupt sein Kreuz den Gipfel hinauf, durch die mit Menschenmassen gefluteten Straßen ziehen muss, schlägt der sonst so behutsam erzählte Film durch die Performance von Phoenix in eine inbrünstige Intensität um, die dem Publikum die Schrecken des Glaubens in Form von der Abscheulichkeit der Intoleranz vergegenwärtigt. Eine aussagekräftige Darstellung, die kurz, aber eindringlich und mit viel Hingabe gespielt ist, sich dafür aber auch ein wenig der Glorifizierung und Mystifizierung bedient.
Die umfangreiche biblische Erzählung wird hier in einen zwei stündiges Werk gepresst. Ein Fakt, den der Zuschauer an manch einer Stelle deutlich zu spüren bekommt, aber dessen Ausmaß noch kein Todesurteil für den Film bedeutet. Allerdings wird bei dem Streifen, der eigentlich genügend Laufzeit bietet, dies zu verhindern, kaum eine Figur neben Maria Magdalena und Jesus von Nazareth genauer belechtet. Die Gefolgschaft Jesu grätscht zwar immer in die Handlung hinein, doch bleiben die Apostel allseamt ziemlich blaß. Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) verkörpert als Jünger Petrus eine derart magere Figur, das man beinahe auf diese verzichten hätte können. Dabei bietet die Geschichte interessante Ansätze, die Hintergründe der Apostel und deren Motivationen aus ihren Blickwinkeln zu beleuchten, wie es beispielsweise mit dem Bestreben Judas gemacht wird, als dieser seinen Propheten verriet. Nur wird auch hier der Handlungsstrang lediglich kurzerhand aufgegriffen, um ihn dann wieder in der Belanglosigkeit zu versenken.
Die Pilgerreise nach Jerusalem stellt allerdings nicht nur Maria, Jesus und seine Apostel auf eine Glaubensprobe, sondern auch den Zuschauer. Mit ständigen neuen Auslegungen des Glaubens wird das Publikum mit einer Bandbreite von Perspektiven konfrontiert, dessen Wahrhaftigkeit nur durch die Individualität eines jeden einzelnen gewährleistet werden kann. DerKonflikt von Verständnis und Missverständnis ist dabei einständiger Begleiter, der nur durch die friedfertige Hoffnung Jesu und seiner Anhänger entkräftet werden kann. Hoffnung ist derAntrieb. Hoffnung auf eine bessere Welt, befreit von den archaischen Hierarchien. Hoffnung auf das Reich Gottes auf Erden. Und bedroht wird diese gutgläubige Zuversicht durch die Herrschaft der Römer. Zwar verzichtet man auf einen großen Auftritt dieser und erblickt in dem gesamten Film nicht einmal eine handvoll Soldaten, doch eben diese Abstinenz lässt die Feindseligkeit des Glaubens als nicht zwingend ersichtlich erscheinen. Schließlich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass jeder Gegner des christlichen Glaubens mit einem Montefortino und roten Umhang ausgestattet ist.
Visuell liefert Maria Magdalena eine gefächerte Bandbreite an prächtigen Bildern, die nicht besonders artifiziell wirken, wodurch die ganze Erzählung – glaubt man sie nun oder auch nicht – ein gewisser realitätsnaher Charakter zukommt. Weite Landschaften, die bis auf die Pilger von einer Menschenleere und einer dementsprechenden Stille gekennzeichnet sind, untermauern den Punkt, dass Jesus und seine Gefährten allein für eine Sache kämpfen, die eigentlich viel zu groß für sie zu sein schien. Im Gegensatz zu diesen weiten Blicken auf die Natur nutzt man bei Maria Magdalena dutzende Close-Ups, die bei der Mimik von Rooney Mara keinen großen Gewinn bringen, doch dank Joaquin Phoenix eine wahre Bereicherung für den Streifen sind. Die vehemente Eindämmung von etlichen biblischen Schwaflereien durch ausdrucksstarke Gesichter tut dem Film erstaunlich gut und verhindert, dass der Zuschauer sich in überstrapazierten Dialogen biblischer Ausmaße verliert. Selbst, wenn Phoenix mit seiner Ausdrucksstärke der titelgebenden Figur größtenteils die Show stielt.



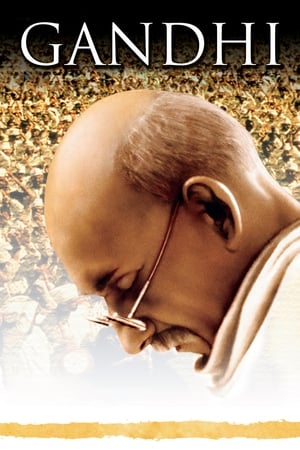
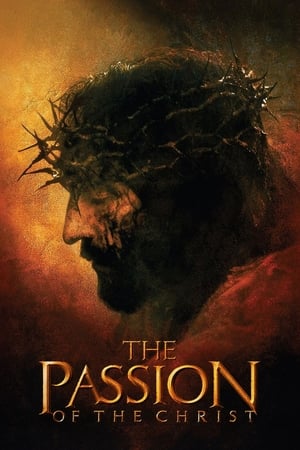


Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!