„Das Einzige was du rausfinden musst, ist was wir mit den Leuten im Keller machen!“
Es begann als Verzweiflungstat, mit dem Streben nach wissenschaftlichen Fortschritt für die gute Sache schön-geflunkert, und nimmt eine Eigendynamik an, dass selbst das geräumigste Verlies im Hobbykeller bald wegen Überfüllung geschlossen werden muss. Unter der Produktions-Ägide von Billig-Horror-Onkel Charles Band („Blood Dolls -Die Killerpuppen“) darf sich der hauptsächlich im TV- beschäftigte Schauspieler Michael Pataki (Mitte der 80er auch ab und zu im Kino, u.a. in „Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts“) mal als Regisseur ausprobieren, was er nach seinem zweiten Spielfilm „Die tolle Geschichte der C.“ lieber wieder sein ließ. Ernsthaft vermisst wird er wohl nicht.
Es ist reine Spekulation, dass der mit dem reißerischen und nicht wirklichen passenden Titel „Das Haus mit dem Folterkeller“ (im Original mit „Mansion of the Doomed“ nur geringfügig weniger) ausgestattete Film unter anderer Schirmherrschaft deutlich besser geworden wäre, die Tendenz geht jedoch klar dahin. Pataki ist die Unerfahrenheit bei der Inszenierung deutlich anzusehen und das Charles Band nicht gerne viel Zeit, Geld und Herzblut in seine unzähligen Schnellschüsse investiert, ist ein offenes Geheimnis. Dementsprechend ungelenk in der Umsetzung und oftmals eher holterdiepolter (und NICHT Folter!) runtergebummelt braucht das Ganze etwas guten Zuspruch und Geduld, doch am Ende ist das alles zumindest nicht ganz so schlecht. Die Idee hat was. Auch wenn sie nicht unbedingt auf dem eigenen Mist gewachsen ist. Offensichtlich steht das Genre-Meisterwerk „Das Schreckenshaus des Dr. Rasanoff“ (bzw. „Augen ohne Gesicht“) ungefragt Pate, ebenso wie klassische Motive der Horrorliteratur, vom Mary Shelley bis Edgar Allan Poe.
Das Hauptaugenmerk liegt auf einem Mad Scientist (Richard Basehart, „Das Lied der Straße“ und im Original tatsächlich die Stimme des „Knight Rider“-Vorspanns), der nicht aus Boshaftigkeit oder einer grundsätzlichen Klatsche zum buchstäblichen Eye-Catcher und Monstrum wird, sondern aus Liebe, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Damit sein Töchterlein ihr Dasein nicht in ewiger Dunkelheit zubringen muss, greift Papa zum Skalpell und sucht unermüdlich unfreiwillige Augen-Spender. Die werden, ganz humanitär, nicht nach gelungener (*hust*) OP entsorgt, sondern tapern im Dunkeln durch den heimischen Zwinger, denn irgendwann will er ihnen das geborgte Material zurückerstatten (das er woher gleich nehmen will? Ein Plan mit klitzekleinen Detaillücken…). Läuft nicht so wie gedacht, das Prinzesschen verbringt mehr Zeit in Narkose als im Wachzustand und hat bald mehr Augen ausprobiert als Schuhe. Während Doktor Skrupellos inzwischen gar keine Grenzen mehr kennt und bei seiner Jagd selbst auf Pädophilen-Methodik zurückgreift (an der Stelle funktioniert der Filme erstmals auf einer befremdliche Art), scharren die blinden Hühner in ihrem Käfig, wollen sich nicht kampflos ihrem Schicksal ergeben.
„Das Haus mit dem Folterkeller“ sieht selten gut aus (das Make-Up ist für die Preisklasse recht ordentlich), hat klare, erzählerische und handwerkliche Defizite und kommt ehrlich gesagt nie an den Punkt, den die Prämisse bereithält und nur manchmal rudimentär an die Oberfläche bricht. Zwischen Horror-Tragödie und wilder Exploitation angesiedelt befindet er sich oft selbst in Narkose, hat aber immerhin den jungen, hier schon positiv, charismatisch-auffallenden Lance Henriksen („Near Dark – Die Nacht hat ihren Preis“), nette Ansätze und einen ganz brauchbaren Schlussspurt im Gepäck, der mit einer zumindest kurzfristig, erinnerungswürdigen Einstellung ausklingt. Das ist es dann aber auch. Es gibt Licht im Dunkel, gar helle Momente, aber sehenswert, den Blick wert oder jedes andere sinngemäße Wortspiel mit „Auge“ (ein Auge drauf werfen?) wäre zu viel des Guten. Nicht unbedingt uninteressant, eher interessant gescheitert. Im Prinzip das Gleiche in Grün, nur mit einer Chance auf mehr.
 Trailer
Trailer



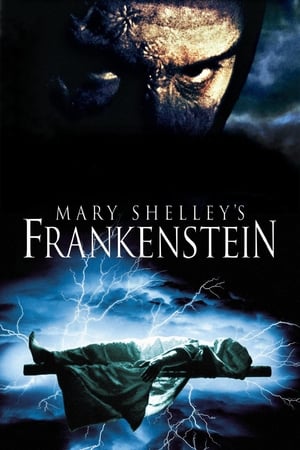

Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!