Es zeugt von einer gewissen Universalität, wenn sich die Themen unserer Erzählstoffe über die Jahrzehnte und Kontinente hinweg ausbreiten und uns als Zuschauende nicht erst begreiflich gemacht werden müssen. Dass uns im Westen, auch ohne jemals einen Fuß in die „neue Welt“ gesetzt zu haben, auf ganz bemerkenswerte Weise etwa die Sensibilitäten und Topoi des US-amerikanischer Kinos vertraut sind, die uns bisweilen gar suggerieren mögen, wir hätten unser halbes Leben in Nordamerika verbracht, hat zwangsläufig zur Folge, dass sich US-Filmemacher*innen nicht explizit darum scheren müssen, uns auf kulturelle Eigenheiten extra aufmerksam zu machen. Ganz anders stellt sich das Geschichtenerzählen jedoch für all jene Kulturräume da, die nicht auf einen besonders starken Heimmarkt setzen können und sich stattdessen darum bemühen, ein Publikum möglichst globalen Ausmaßes zu erreichen. Als etwa 1924 der 40-jährige Franz Kafka an einer Tuberkulose-Erkrankung verendete, eine Nachricht an seinen engen Vertrauten Max Brod hinterlassend, er möge seine Texte restlos verbrennen, mochte er sich kaum vorgestellt haben, dass seine Texte einmal die Lehrpläne westlicher Universitäten erobern und eines der meistgelesenen Werke deutscher Sprache markieren würden. Ebenso verwundert wäre er vermutlich gewesen, sein Motiv einer zum Selbstzweck geratenen Bürokratie weniger als drei Dekaden später am anderen Ende der Welt verbildlicht zu sehen, im wunderbar intimen Ikiru des japanischen Großmeisters Akira Kurosawa.
Ikiru, das ist ein Film, der zugleich zeitlos und zeitgebunden wirkt, und dessen Adaption aufgrund der Spezifität, mit der Kurosawa uns während der letzten Wochen am Leben seines Protagonisten Kanji Watanabe (Takashi Shimura, Rashomon) teilhaben lässt, Universalität erreicht. Nachdem diesem eine Krebserkrankung im Endstadium diagnostiziert wird, zecht er eine Nacht mit einem mysteriösen Schriftsteller (Yūnosuke Itō) umher, der nur allzu schnell wieder aus dem Leben Watanabes verschwindet, sobald dieser seine einzige Maxime, Watanabe solle die verbliebene Zeit voll auskosten, verinnerlicht. Auch eine solche Nacht mit all ihren Reizen, dem Karaoke und ihrer schnapsdurchtränkten Melancholie muss zu einem Ende finden, doch in diesem verbirgt sich, anders, als zunächst absehbar erscheint, vor allem ein Anfang, symbolisiert durch den neuen Hut, den sich Watanabe vom Faust-haften Schriftsteller anraten lässt.
Kurosawas Ikiru nimmt noch heute ein Publikum aus aller Welt für sich ein, weil es uns aufzeigt, wie uns das uns inhärente Phlegma schneller einholt, als wir es uns eingestehen. In einer Welt, die allzu oft zweckgebunden daherkommt, ohne unsere Sehnsucht nach Sinn im eigentlichen Sinne zu befriedigen, ist es nicht selten der gemeine Alltag, an dessen Struktur wir uns in diesem Meer an Formlosigkeit mit großer Hilflosigkeit klammern, da es uns zu selten gelingt, die Kraft dafür aufzubringen, dagegen anzuschwimmen. Kurosawa erkannte das menschliche Phlegma als beinah unausweichlich und stellte dieser jene Hypokrisie gegenüber, die sich mitunter in den periodischen Schwindeleien ausdrückt, die wir uns in schöner Regelmäßigkeit selbst erzählen, um uns von einer besseren Version unserer selbst zu überzeugen, der wir von nun an versuchen würden zu entsprechen.
Wollte man es böse meinen mit Oliver Hermanus (Moffie), so würde man auch in seinem neuesten Film Living jenes menschliche Phlegma identifizieren, das das Kino nun seit Jahrzehnten in seiner Gewalt hält: das wiederholte Neuauflegen altbekannter Geschichten, die durch ihre mehr oder weniger bekannten Titel einen Anknüpfpunkt für die Zuschauer*innen bieten und derer zahlreich in die Kinosäle oder zumindest zum Streamen bewegen sollen. Die Geschichten enden nicht mehr, ihnen werden stattdessen weitere vorangestellt oder nachgeschoben, wenn sie nicht einfach wiederholt werden. Es ist das Ende des Endes der Geschichte(n). Jener Oliver Hermanus stellt nun mit der britischen Neuauflage des japanischen Meisterwerks eine solche, wenig ambitionierte Wiederverwertung eines dem oder der Cinephilen geläufigen Titels vor. Handwerklich gibt es da wenig zu beanstanden, handelt es sich bei Living doch um eine kompetent inszenierte, wahrlich schön fotographierte Neuauflage Ikirus. Der Kontext mag sich geändert haben, das Tokyo der Folgejahre des Zweiten Weltkrieges weicht dem London des selbigen Zeitraumes, doch die Geschichte kann offenbar nicht anders, als sich zu wiederholen. Mit dem gravitätischen Bill Nighy (Emma), der die Watanabe-Figur Williams verkörpert, gelingt Hermanus ein Volltreffer, doch auch Tom Burke (The Souvenir) könnte als Schausteller und Inszenator Sutherland, der der geheimnisvollen Schriftstellerfigur des Originals entspricht, nicht besser gewählt sein. Aimee Lou Wood (Sex Education) fällt es indes zu, Williams junge Kollegin Margaret zu verkörpern und als diese eine erfrischende Unbeschwert- und Unbedarftheit mit einer natürlichen Liebenswürdigkeit zu paaren, die Williams allem voran echte Freude am Leben bereitet.
Doch das Talent vor und hinter der Kamera genügt nicht, um diesem Remake eine weitergehende Eigenständigkeit zu verleihen. Zwar werden uns hier ganz wunderbare visuelle Einfälle geboten (die Arbeit mit altem Material der Stadt London oder die tabellenartigen Credits), die bereits mit dem Vorspann einsetzen und uns glauben lassen, einen Film der 40er oder 50er Jahre zu sehen, krankt der Film doch insbesondere daran, dass er sich bisweilen zu sehr wie ein sentimentaler Hollywood-Film dieser Ära anfühlt. Denn obgleich Vorlage und Neuinterpretation ähnliche Sentiments teilen, so ist Ikiru doch allem voran ein vorwärts gewandter Film, der uns zumindest für einige Zeit in der Illusion schwelgen lässt, unser Leben zukünftig grundlegend zu verändern. Living hingegen ruht sich im gemachten Bett aus und bemüht sich selten darum, die altbekannten Themen auf irgendeine Weise zu variieren oder in einen Dialog mit der Gegenwart zu bringen. Wie Watanabe setzt sich nun auch Williams dafür ein, den Bau des Spielplatzes zu genehmigen, auf dessen Bau eine Gruppe dreier Damen auf nimmermüde Weise pocht. Und auch der neue Hut, den sich Watanabe im Kurosawa-Film zulegt, passt, wenig verwunderlich, nun auch auf den Kopf des gleichsam würdevollen wie bemitleidenswerten Williams, dessen Verkörperung durch Bill Nighy diese Balance auf ganz wunderbare Weise aufrechterhält.
Das alte Rezept, so ist man geneigt zu sagen, hat nicht an Würze verloren und mundet noch immer ganz wunderbar. Einzig, die Welt hat sich weitergedreht, und Regisseur Hermanus lässt gänzlich außer Acht, dass sich unsere Zutatenpalette erweitert hat. Dass der Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, mag verwundern und tut es auch nicht, schließlich zeichnen sich die Romane Ishiguros vor allem durch eine nicht in anderweitige Worte zu übersetzende Melancholie aus, ganz gleich, ob diese durch einen alten Butler (The Remains of the Day), einen Klon (Never Let Me Go) oder einen Humanoiden (Klara and the Sun) vermittelt werden. Der Transfer dieser Sprache, die auf bemerkenswerte Weise eine Lyrik im Prosaischen findet, übersetzt sich indes nur selten in die Bilder, die Hermanus findet. Stattdessen verlässt sich dieser auf seine herausragenden Darsteller*innen, die ihr Bestes geben, uns über die Inspiriertheit und Mutlosigkeit dieser Adaption hinwegsehen zu lassen. Und bisweilen haben sie damit sogar Erfolg.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org


















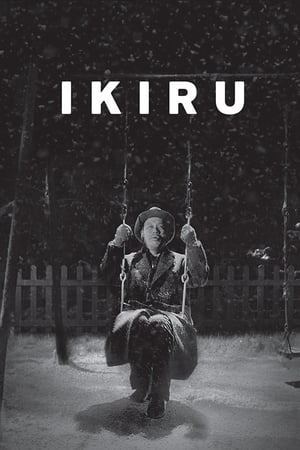
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!