Quelle: themoviedb.org
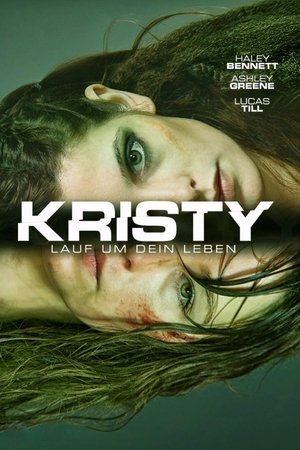 Trailer
Trailer
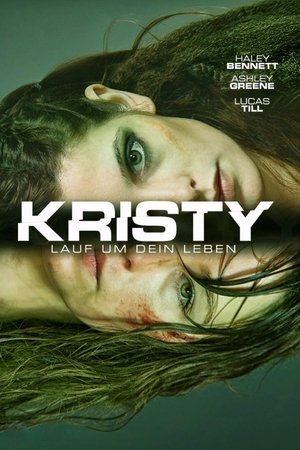
- Start 07.08.2014
- 85 Min HorrorThriller USA
- Regie Olly Blackburn
- Drehbuch Anthony Jaswinski
- Cast Haley Bennett, Ashley Greene, Lucas Till, Chris Coy, Mike Seal, Lucius Falick, Erica Ash, James Ransone, Mathew St. Patrick, Al Vicente, Anna Skidanova, Dane Rhodes, David Jensen, Chelsea Bruland, Wayne Pére, Jaylen Moore
Inhalt
Kritik
Fazit
Kritik: Jacko Kunze
Wird geladen...
×