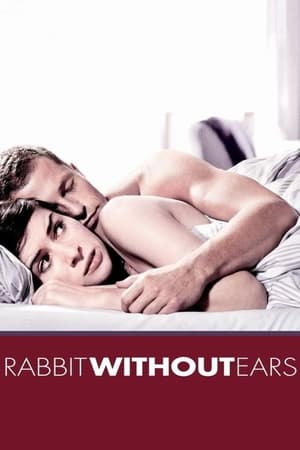Der Erfolg gibt Til Schweiger Recht: Seine inzwischen zehnte Regiearbeit „Honig im Kopf“ lockte bereits über sieben Millionen Zuschauer in die Kinos und konnte damit die außerordentlichen Besucherzahlen von „Keinohrhasen“ (über 6 Millionen Zuschauer) aus dem Jahre 2007 übertrumpfen. Wer da heute wirklich noch zu der Behauptung ausholen möchte, dass Til Schweiger die Massen nicht auf seiner Seite hätte und nicht als DER deutsche Superstar gewertet werden darf, dessen Name allein schon dafür garantiert, dass die Kassen in lieblicher Melodie klingeln, der befindet sich schlichtweg auf dem Holzweg. Dass sich da zwischen Til Schweiger und der Filmkritik seit geraumer Zeit einige heftige Diskrepanzen angesammelt haben, die der gebürtige Breisgauer aber keinesfalls auszufechten gedenkt (für ihn ist das Feuilleton eben ein Haufen unseriöser Hampelmänner, oder so ähnlich), gießt natürlich noch weiter Öl ins Feuer, genauso wie der Umstand, dass nur einer ausgewählten Journalistenschar Zugang zu den Pressevorstellungen seiner Filme gewährt wird.
Die negativen Besprechungen seiner Filme aber rühren nicht daher, dass man Til Schweiger eins auswischen will, weil er seine (Mach-)Werke nur einem elitären Zirkel vorab vorführt und der Rest der deutschlandweiten Schreiberlinge sich das private Vermögen aus dem Portemonnaie schütteln muss, um sich über Til Schweigers Qualitäten als Filmemacher in Kenntnis setzen zu lassen. In Wahrheit ist es so, dass Til Schweiger zwar den Geschmack der breiten Masse bedienen mag, darüber hinaus aber vor allem immerzu gleichförmiges Anti-Kino abliefert, dem man sich bei klarem Menschenverstand kaum hingeben kann. Wobei, das ist nun doch zu arrogant ausgedrückt: Jedem sei das Vergnügen an „Honig im Kopf“ vergönnt, allerdings muss man in diesem Fall durchaus die Aussage fällen, dass man an „Honig im Kopf“ nur dann Gefallen finden kann, wenn man zu keinem Zeitpunkt dem Verlangen erliegt, das Gezeigte ernsthaft zu hinterfragen. Nur führt das zu der Frage: Wie kann man eine so gewichtige Thematik wie die Alzheimer-Demenz nicht hinterfragen?
Würde man „Honig im Kopf“ nämlich auf seinen Wahrheitsgehalt abklopfen – und dabei natürlich immer in Relation mit der Alzheimer-Demenz stellen, die uns und unsere Liebsten in der Realität jederzeit heimsuchen kann -, dann muss man schon in aller Drastik verkünden, dass sich Til Schweiger eher auf eine verklärende Ultralight-Behandlung der Krankheit beruft, gerade so zurechtgebogen, wie es dem allgemeinen Konsens zuträglich und zumutbar erscheint. Wie gewohnt gibt Til Schweiger hier den erfolgreichen Geschäftsmann, sein Name Niko, der um die Welt jettet und auch mal Frauen auf den Rücken legt, die nicht seine Frau sind. Dass seine Gattin Sarah (Jeanette Hain, „Der Vorleser“) den gleichen Fehler mit ihrem schmierigen Chef Serge (Jan Josef Liefers, „Mann tut was Mann kann“) begeht, reibt „Honig im Kopf“ ihr tatsächlich immer wieder unter die Nase, in dem Til Schweiger Sarah von Beginn an als verhärmter Drachen inszeniert, der nicht nur mit ihrem Vorgesetzten pimpert, sondern sich auch später die Frechheit herausnimmt, den Krankheitszustand von Opa Amandus (Dieter Hallervorden, „Sein letztes Rennen“) kritisch zu beäugen.
Dass weder Niko noch seine Tochter Tilda (Emma Schweiger, „Kokowääh“) akzeptieren wollen, dass es dem Opa offenkundig schlechter geht, gehört letztlich natürlich dazu und lässt sich als ganz natürliches Verhalten verstehen, wenn es einen Schicksalsschlag im engsten Familienkreis zu betrauern gibt. Seltsam aber ist nur, dass „Honig im Kopf“ Sarah beinahe schon zu einer Art Antagonisten stilisiert, während der juvenile Schwerenöter Niko sich herausnehmen kann, was er will: Immerhin bemüht er sich ja auch um seine Tochter, auch wenn da ebenfalls so manches Handeln in die Hose geht. Ob Til Schweiger dieses Menschenbild eher unbewusst pflegt, oder ob dort tatsächlich eine gewisse Misogynie mitschwingt, denen er bei seinen Leinwandausflügen Ventil verleiht, sei erst mal dahingestellt, unglücklich gelöst ist es zweifelsohne. Aber „unglückliche Lösungen“ gibt es in „Honig in Kopf“ zu genüge: Es ist ein Unding, dass Til Schweiger die Alzheimer-Demenz dazu instrumentalisiert, um das (angebliche) Humorpotenzial der Krankheit auszureizen, anstatt sich auf den kognitiven Verfall und die Auswirkungen auf das soziale Umfeld zu konzentrieren.
Würde es Til Schweiger hier wirklich um ein ernstes Anliegen gehen, dann wäre „Honig im Kopf“ nicht dieses manipulative Rührstück geworden, dass den dementen Opa mit den verheulten Kulleraugen (mein Gott, is' der niiiiiedlich) auf seine schusselige Tüdeligkeit reduziert: Bücher im Kühlschrank und das Überfahren von roten Ampeln, weil man ja nur bei Grün halten muss. Brüller! Besonders peinlich wird es dann aber wenn, wenn Amandus mit seiner Enkelin in einem Kloster Rast macht und Opa die hiesigen Nonnen mit einem famosen Witz darüber aufklärt, dass man Gurken nicht nur in den Salat schnippeln kann, um dann bei Nacht die verstorbene Oma in einer Madonnenfigur wiederzuerkennen und „Honig im Kopf“ in eine irritierend religiöse Richtung zu drängen. Dass es bei der Alzheimer-Demenz-Thematik zwangsläufig auch um den Tod geht und da eben auch der Glaube eine nicht unwesentliche Rolle spielen wird, versteht sich von selbst. „Honig im Kopf“ aber packt den Holzhammer aus und haut in bedeutungsschwangerer Symbolik auf den Zuschauer ein, dass das repetitive Pianogeklimper auf der Tonspur seine helle Schwierigkeit hat, hinterherzuschmalzen.
Mit der Wirklichkeit hat „Honig im Kopf“ nichts zu tun, auch wenn uns das Til Schweiger, der sich gerne mal als didaktischer Volksaufklärer geriert, und seine unzähligen Fanbriefe, die er mit stolzer Brust auf seiner Facebookseite ausstellt, vorzugaukeln versuchen. Elemente wie die seelische Betreuung, der Machtkampf mit den Krankenkassen und die bitteren Schuldgefühle, die aufkeimen, wenn man sich eingestehen muss, dass man seinen eigenen Vater nicht mehr bewältigen kann, werden in „Honig im Kopf“ zum Teil zwar alibimäßig angesprochen, aber nie auch nur im Ansatz grundiert. Til Schweiger beschränkt sich auf Binsenweisheiten (besonders beliebt: „Der Weg ist das Ziel“), eine Familienwiedervereinigung in Zeitlupe und infantile Plattitüden. Lässt Hallervorden im konfusen Didi-Modus furchtbare Zoten zünden und stellt ihm mit Tilda eine 11-Jährige an die Seite, die ihren Großvater schon in einem mehr als pathologischen Ausmaß idealisiert, dass sie selbst dann noch ein Lächeln auf den Lippen trägt, wenn er ihr ganz ungeniert ins Gesicht furzt: „Das habe ich gehört!“, jauchzt sie ihrem Opa da entgegen. Irre, dieses Schweiger'sche Paralleluniversum!
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org