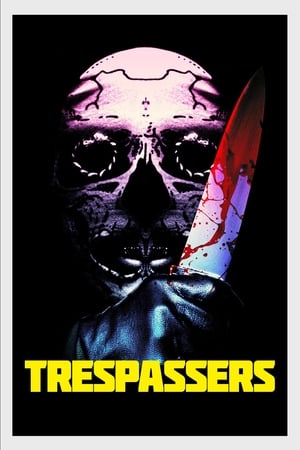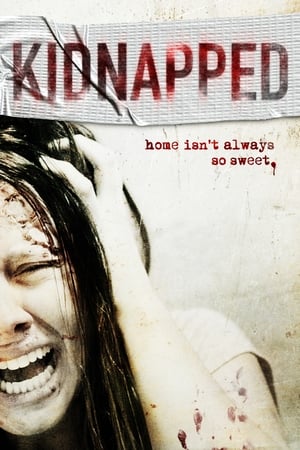Das Sub-Genre Home Invasion ist im bald vergangenen Jahrzehnt wieder richtig salonfähig geworden. Zwar selten auf der ganz großen Leinwand wie z.B. bei You're Next oder The Purge - Die Säuberung, dennoch wurde speziell im kleiner budgetierten Bereich vermehrt mit der altbekannten und bewehrten Prämisse gearbeitet. Zum Teil wirklich anständig, oftmals natürlich auch ohne größere Daseinsberechtigung. Viel mehr als das dürften die Meisten auch hinter Hell Is Where the Home Is nicht vermuten. Eine kleine, nur sehr geringfügig promotete Produktion von bis dato kaum in Erscheinung getretenen Low-Budget Newcomern. Vornehmlich Material als Festival-Lückenfüller oder Blindkauf-Spekulationen im Heimkinoregal. Doch aufgehorcht, liebe Genre-Freunde, dieser Film kann tatsächlich etwas. Nichts Neues, aber das was er anpackt, setzt er auf schon fast erstaunlich höherwertige Art und Weise um.
Der größte, augenscheinlich unspektakuläre und eventuell sogar unbeachtete Kniff gelingt Regisseur Orson Oblowitz und Drehbuchautor Corey Deshon nämlich in dem durchwegs dominanten Spiel mit der Erwartungshaltung und der vermeidlichen Monotonie der immer gleichen Muster. Ein Pärchen mietet für einen Wochenendtrip in der Mojave-Wüste eine schicken Luxus-Bunker (übrigens die selbe Bude, die es schon im Jahr davor im französischen Edel-Reißer Revenge zu beneiden gab) und bringt noch zwei Freunde mit, wobei selbst der blindeste Krückstockschwinger sofort merkt, dass da einiges im Argen liegt. Die Beziehung von Sarah (Angela Trimbur, The Final Girls) und Joseph (Zach Avery, Herz aus Stahl) steht gewaltig auf der Kippe. Ungünstig obendrein: Sarah ahnt (noch) nicht, dass die von ihr eingeladene, mit der Zeit etwas endfremdete beste Freundin Estelle (Janel Parrish, Pretty Little Liars) vor Kurzem eine Affäre mit Joseph hatte. Zudem hat sie ihren extrem unangenehmen Boy-Friend Victor (Jonathan Howard, Godzilla 2: King of Monsters) im Schlepptau, der mehr Koks als Sauerstoff durch die Nase inhaliert.
Drogen, viel Alkohol und unausgesprochene, aber konstant brodelnden Konflikte: Von den im Opener direkt angeteasten, maskierten Macheten-Meuchelmördern noch nichts zu sehen, leistet das gezwungen lockere Quartett unfreiwillig Vorarbeit nach Maß. Es wird sich ordentlich betankt und es schwelen bereits interne Flächenbrände, noch bevor von außen auch nur ein zaghafter Versuch zur Intervention unternommen wird. Das der kommen wird ist allein wegen der Eröffnungsszene in Stein gemeißelt und in der Regel würden die meisten Filme keine Zeit damit verschwenden, wenn durch den Vorlauf die notwendige Mindestlaufzeit irgendwie erreicht wäre. Hell is Where The Home Is ist da anders. Eine wenig wie 2013 Home Sweet Home, in dem auch glasklar war, was passierend wird, das Wie und Wann aber geschickt herausgezögert wurde. Was anderweitig mit Langweile verwechselt wird, ist die eigentliche Stärke. Im Gegensatz zum erwähnten Beitrag wird hier sogar ständig etwas Effektives geboten. Immer am Rande des „Kenne-ich-doch“-Klischee, aber meistens in wichtigen Details abgewandelt. Als eine schrullige, angebliche Nachbarin mit Autopanne vor der Tür steht (ein Wiedersehen mit der fast vergessenen Fairuza Balk, Das Leben nach dem Tod in Denver) und um Einlass bittet, sind sich sowohl Zuschauer als auch die Hälfte der Figuren einig: Das wird nicht gut gehen.
Es kommt, wie es kommen muss. Exakt zu erläutern, warum Hell Is Where the Home Is damit sehr geschickt und angenehm durchdacht hantiert, würde zu sehr einem Spoiler gleichkommen. Um es kurz und oberflächlich genug zu fassen: Man weiß genau, was passieren wird, der Weg dahin hat aber immer mal kleine, notwendige und clevere Abweichungen parat. Die sind für sich genommen nicht sensationell, aber sie zögern den großen Knalleffekt auf vorteilhafte Weise hinaus, gewährleisten einen durchgehend straffen Erzählfluss und wenn mal endlich gut ist mit dem Vorgeplänkel, wird auch saftig auf die Kacke gehauen. Das drastische Finale ist beinah sogar der schwächste Part eines bis dato überraschend starken Films, da hier jetzt alles wie auf Schienen straight nach vorne läuft. Was auch nicht verkehrt ist und man ohnehin schon nach 30 Minuten erwartet hätte. Der Weg zum Ziel, der ist ziemlich ordentlich geworden. Auffällig auch durch eine kompetente Inszenierung, die wie vieles in letzter Zeit auch die Retro-Welle reitet, allerdings längst nicht so aufdringlich und gezwungen. Der Score hat anfangs markanten Italo-Einschlag, wechselt mit der Zeit um zum 80er-Synthesizer. Die Giallo-Referenzen – speziell zu Dario Argento – sind irgendwann nicht mehr von der Hand zu weißen, wenn das prunkvolle Wochenend-Exzess-Gefängnis nur noch in schillernde Blau- und Rottöne getaucht wird und die Luchador-Invasoren die Macheten kreisen lassen.