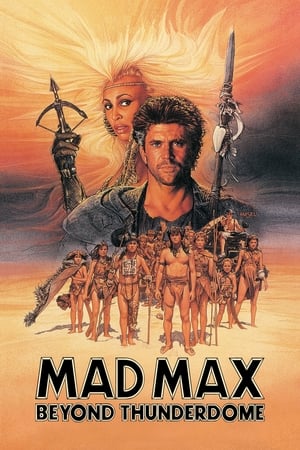Die Zahlen sind beachtlich. Teil 1 von „Mad Max“ kostete nicht einmal eine halbe Millionen australische Dollar, erwirtschaftete weltweit aber über 100 Millionen, so dass der raue Actionfilm 20 Jahre lang den Rekord hielt, für den Spielfilm mit der besten Umsatzrendite. Der finanzielle Erfolg von „Mad Max“ gilt bis heute als offensichtlicher, feuchter Traum der großen Studios und Produzenten. Doch eigentlich war es „Mad Max 2 - Der Vollstrecker“, der dafür verantwortlich war, dass die Reihe den Weg zum Kinoolymp fand. Teil 2, der in den Vereinigten Staaten als „The Road Warrior“ vermarktet wurde, (der Vorgänger war dort, im Gegensatz zum Rest der Welt, kein großer Erfolg), gilt bis heute als DIE Blaupause für viele rohe, dystopische Gegenentwürfe von strahlenden Besserwelt-Utopien, die sich nach dem Erfolg des Sequels vermehrt im Bereich der Videopremieren ihren Weg ins kinematische Bewusstsein bahnten (z.B. Albert Pyuns Trashfest „Cyborg“ oder Kevin Costners Ego-Show „Waterworld“). Ans Original kamen sie dabei nur selten heran. Übertrumpfen konnte den Straßenkrieger keiner und sogar die Bild-Zeitung huldigte erst letzten Winter unfreiwillig mit ihrem Anti-Journalismus zumindest den brachialen Fuhrpark des Films (siehe hier). Als 1985 dann mit „Mad Max 3 - Jenseits der Donnerkuppel“ der langerwartete dritte Teil herauskam, schien es fast so, als ob die Macher müde waren den schweigsamen Max durch die karge Landschaft futuristischer Verdammnis zu schicken. Das Ergebnis war vielen zu weich, poliert und zahm. Kein Abschied nach Maß.
30 Jahre später ist er wieder zurück und um das gleich einmal vom Tisch zu räumen, „Mad Max: Fury Road“ ist weder Reboot noch Remake. Es ist ein klassisches Sequel. Eines, welches man ohne Vorwissen genießen kann, welches aber selbstverständlich für alle Eingeweihten genug Material bietet, um in Erinnerungen zu schwelgen und sich ein wenig überlegen zu fühlen, zu all jenen, die hier ihren Max-Einstand feiern. Dass es dazu kam ist dabei fast schon ein Wunder. Ewigkeiten verbrachte der Film in der development hell der Traumfabrik. Das Projekt wurde befeuert und dann wieder eingestampft. Gerüchte kamen und gingen, Ideen wurden verbreitet und dann wieder zurückgezogen. Für Fans der Trilogie gewiss ein Spießroutenlauf. Als Mel Gibson, Darsteller des Kulthelden Max Rockatansky, dann zunehmend „zu alt für den Scheiß“ wurde und sich mit antisemitischen, rassistischen und misogynen Äußerungen und Taten seinen hervorragenden Ruf als Action-Heroen und Sonnyboy innerhalb eines Jahre selbst versaute, sah es endgültig danach aus, dass Teil 4 ein Hirngespinst von Fan und Machern bleiben wird. Dass es nun doch anders kam liegt neben einem Studio, welches sich durchaus traute ein ergrautes Franchise wiederzubeleben, auch an Regisseur George Miller. Der Australier, der mittlerweile 70 Jahre alt ist, hat eine so wechselhafte wie interessante Filmographie zu bieten und war seit langem aus dem erwachsenen Blockbusterkino verschwunden. Untätig war er nie.
Miller war stets ein Austester. Jemand, der sich versuchen wollte mit für ihn neuen Genre-Mechaniken. Nach seiner „Mad Max“-Trilogie versuchte er sich erfolgreich an tränenreichen Überlebenskampf-Dramen („Lorenzos Öl“), genau wie an einer phantasiereichen, feministisch geprägten sowie bissigen Vorstadt-Satire („Die Hexen von Eastwick“). Als Produzent sowie Autor war er außerdem mit dafür verantwortlich, dass 1995 Millionen von Familien nach dem Kinobesuch versuchen wollten Vegetarier zu werden („Ein Schweinchen namens Babe“). Millers berufliche Vita bietet in Sachen Quantität nichts gigantisches, aber sie offenbart relativ klar, dass es sich hierbei um einen Regisseur handelt, der zum einen die Herausforderung sucht und sich zum anderen stets auch mit verschiedenen Thematiken und Produktionsprozessen beschäftigt - sogar mit Animationsfilmen. 2007 erhielt er einen Oscar für sein Pinguin-Musical „Happy Feet“. Wer „Happy Feet“ und dessen Fortsetzung gesehen hat, ohne Millers vorheriges Werk zu kennen, wird sich mit großer Sicherheit verdutzt am Kopf kratzen, wenn er es mit „Mad Max: Fury Road“ zu tun bekommt. Von Nettigkeiten, Feel-Good-Musik und Tanzeinlagen ist dieser nämlich ungefähr so weit entfernt wie schales, alkoholfreies Bier vom Ruf ein neuer Trenddrink zu sein.
Millers Wille, Neues zu versuchen, schlägt sich in „Mad Max: Fury Road“ vor allem in Sachen Drehbuch nieder. Der vierte Teil besaß nämlich nie wirklich eines. Miller hatte nur eine festgesetzte Reihenfolge von Szenen und Ideen ausgearbeitet. Der Rest kam während des Drehs, war Improvisation und gewiss auch blanker Wahnsinn – vielleicht hin und wieder auch etwas ertragreiche Verzweiflung. Aber ernsthaft, was kann man von einem Mann erwarten, der Pinguine singen ließ und Ferkel zu Hirtenhunden machte? Aber keine Sorge, gesungen wird im vierten Teil der Reihe nicht. Selbst geredet wird nicht viel. „Mad Max: Fury Road“ ist phasenweise ein nonverbales Erlebnis. Schreien, kreischen, brummen sowie Blicke und Gesten ersetzen vor allem in der ersten Hälfte das Verbale. Dennoch, alles bleibt klar verständlich. Die Beweggründe und Emotionen der beiden Hauptfiguren, Max und Furiosa, sind stehts klar erkennbar. Wahre charakterliche Entwicklung sollte man aber nicht erwarten. Hier setzt Miller auf Hausmannskost, die er aber gekonnt und ohne Länge zubereitet und serviert. Garniert wird das Ganze dann gerne auch mit sehr kurzen wie trockenen Humorspitzen, aus dem Hause der Ironie.
Dass „Mad Max: Fury Road“ im Prinzip eigentlich nur eine lange Verfolgungsjagd ist, beherbergt die Gefahr, bereits nach kurzer Zeit gesättigt zu sein. Doch dazu kommt es nicht. Dass liegt nur zweitrangig an kleineren Ruhepausen innerhalb der Handlung, sondern vielmehr an der faszinierten Welt, die Miller seinem Publikum präsentiert. Wer die Vorgänger kennt, wird eine gewisse Logik erkennen. Gab es in Teil 1 noch kleiner Ortschaften und sogar eine Polizei, so herrscht in „The Road Warrior“ schon nur noch Anarchie und Gewalt. Im dritten Teil dann gab es mit Bartertown den ersten Versuch einer Stadt mit neuen Gesetzen. In „Mad Max: Fury Road“ ist nun alles noch etwas dreckiger, verstaubter, hoffnungsloser. Durst, Hunger und Krankheit haben die restliche Überlebenden noch weiter ausgemergelt, während die wenigen mit Macht, ihre Stellung mit feistem Bizarro-Prunk und widerlichem Proleten-Protz zur Schau stellen. In wohl keiner Filmreihe sah man unsere Welt wohl so rigoros vor die Hunde gehen, wie in „Mad Max“. In einer Szene steht „Who killed the world?“ mit weißen Lettern auf einer Wand geschrieben. Regisseur Miller geht niemals soweit mit seiner Dystopie einen gesellschaftliche oder ökonomischen Kommentar abgeben zu wollen, doch trotzdem, sein Schreckensszenario besitzt immer auch etwas Reflektierendes zu unserer Gegenwart. Das wahrnehmen ist allerdings keine einfache Aufgabe. Dafür heulen die Motoren zu laut.
Eigentlich ist in „Mad Max: Fury Road“ alles laut. Zu laut und das ist auch gut so. Wenn die grotesken Freak-Karossen durch den trockenen Wüstenstaub peitschen, absurde Trucks mit feuerspeienden Gitarrenspielern und scheinbar nie müde werdenden Taiko-Trommlern sich ihren Weg durch die Ödnis bahnen und das Heldengespann mit einem gepanzerte Tanklastwagen, dem Pequod der Wüste, durchs todbringende, sandverpestete Niemandsland brettern, dann bebt der Boden des Kinosaals. Die fulminante Musikuntermalung von Junkie XL tut ihr übriges dazu, genau wie die diversen Granateneinschläge, fliegende Projektile und Schreie in allen mögliche Variationen. Gemeinsam mit den wunderbaren Bildern von Kamera-Ass John Seale („Der englische Patient“) ergibt das große Ganze eine wild pochende, stets aber auch harmonische Symphonie der Destruktion, bei der hinter all der räudigen Sentenz auch immer reinrassige Faszination sowie grobschlächtige Sinnlichkeit mitschwebt. Anders ausgedrückt: Wenn es hier kracht dann meist immer im erstaunlichen Maße und trotz der Größe der Bilder, lässt sich nicht verschweigen, verbergen oder gar vergessen, wie viel Herzblut und Detailversessenheit darin steckt. Action at his best, die selbst die hochgezüchtete Actionpumpe eines „Fast & Furious 7“ irgendwie recht lieblos und halbherzig erscheinen lässt. „Mad Max: Fury Road“ ist ein Highway, „Fast & Furious 7“ irgendwie ein Auto-Scooter.
Action at his best auch weil „Mad Max: Fury Road“ seinen eigenen Weg geht. Natürlich bleibt Miller dem Grundlook seiner Filmreihe treu. Er erweitert sie aber logisch und es gelingt ihm darüber hinaus analoge und digitale Technik so miteinander zu verbinden, dass die Bilder zwar klar sind, aber dennoch nie so wirken, als kämen sie gerade frisch von der Reinigung. Dazu erlaubt er sich auch Pessimismus und schön schrecklich schräge Überspitzungen. Daraus resultiert, dass „Mad Max: Fury Road“ im Gegensatz zu den letzten großen Blockbustern nie Opfer engansitzender Konformität wird. Der Film geht seinen Weg und obwohl er zu einem (fast vergessenen?) Franchise gehört, wirkt er doch wie ein Unikat, ein wunderschönes Einzelstück mit horrendem Seltenheitswert. Dass Mel Gibson nun nicht mehr der Titelheld ist, ist verschmerzbar. Tom Hardy erweist sich als passgenauer, neuer Max Rockatansky. Man muss als Zuschauer schon sehr verbohrt und gekränkt sein, um wirklich Gibson nachzutrauern, der sich nun einmal auch gewiss selbst aus dem Rennen um die Rolle gebracht hat. Scheinbar kann er damit aber leben. Auf der Weltpremiere von „Mad Max: Fury Road“ war er anwesend und wohl gut gelaunt.
Die zwei wichtigsten Figuren neben Max sind zum einen der Wüsten-Diktator Immortant Joe und die einarmige Kriegerin Furiosa. Beide drücken, wie Hardy auch, dem Film ihren Stempel auf. Fans des ersten Teils können sich freuen, denn mit Hugh Keays-Byrne spielt der damalige Darsteller der Ur-Schurken Toecutter erneut einen (aber nicht denselben) Widersacher des durchgeknallten Maximilians. Immortant Joe bleibt als Fiesling leider immer etwas zu fern und gestelzt. Dank seiner ikonographischen Aufmachung haftet er sich dennoch ins Gedächtnis, genau wie seine Vasallen, die Miller scheinbar direkt aus David Lynchs Bestseller-Verfilmung „Dune – Der Wüstenplanet“ geborgt hat. Wesentlich deutlicher und verdienter in guter Erinnerung bleibt aber Charlize Theron. Ihre Furiosa ist kein plumpes Prinzessinchen, sondern eine ebenbürtige Gegner, bzw. Kameradin für Max. Die Story von „Mad Max: Fury Road“ lässt sicherlich den Schluss zu, dass hier Gleichberechtigung erneut mit Füßen getreten wird und teilweise hinterlässt der Film auch einen bitteren Beigeschmack, doch bei Furiosa nicht. Ihr Kampfeswille wirkt hier und da sogar noch größer als der von Max, vielleicht weil sie noch an etwas glaubt, was dieser schon lange vergessen hat: Hoffnung.
In der Ära der Marvel-Filme, die – trotz eines nicht zu unterschätzendem Unterhaltungswertes- sich (mittlerweile schlauchende und wenig kreative) Konformität auf die wehenden Banner geschrieben haben, wirkt ein Film wie „Mad Max: Fury Road“ fast schon wie ein Rocker, ein Rebell. Es wäre vermessen und falsch zu behaupten, dass George Miller mit Teil 4 seiner Actionreihe das Massenkino neu erfindet oder es wenigstens saniert. Er macht dafür aber etwas anderes. Er huldigt dem Rausch cineastischer Attraktion, die von vorne bis hinten, von A bis Z, von Anfang bis Ende so wunderbar stimmig und dennoch stets kernig und eigen daherkommt, dass es einem den Atem raubt. Von „Fast & Furious 7“ wird in drei Jahren vielleicht noch die Szene mit Dwayne Johnson und der Gatling Gun übrig bleiben. „Avengers: Age of Ultron“? Gab es da nicht diese Szene mit Thors Hammer? Aber von „Mad Max: Fury Road“ bleiben nicht einfach Szenen zurück, sondern ein euphorisches Gefühl. Das Gefühl endlich wieder im Kino gesessen zu haben, um etwas zu erleben. Wer sich für den Film interessiert und selbst sehen und vor allem erfahren will, wie ein 70jähriger, australischer Regisseur scheinbar mühelos und mit großem Esprit die Konkurrenz düpiert, der sollte sich Tom Hardys Dystopie-Debüt ansehen. Nicht als Stream, nicht auf DVD, auch nicht auf Blu-ray. „Kino. Dafür werden Filme gemacht“ lautet ein bekannter Werbeslogan und er passt hier perfekt, denn: „Mad Max: Fury Road“ ist Kino!
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org