Was treibt einen Menschen an, im Alleingang eine Kletterroute unter Verzicht von technischen Hilfs- und Sicherungsmittel zu begehen? Der Adrenalinkick, der diese Erfahrung ausmacht? Der Drang zur Selbstzerstörung, der jedem menschlichen Wesen mit der Geburt eingepflanzt wurde? Alex Honnold, eine Koryphäe auf dem Gebiet des Free Solo Climbing, hat viele Antworten auf diese Frage. Eine davon lautet auch, dass er hier ein Ventil gefunden hat, um sich ein Stück weit aus dem Abgrund der Selbstverachtung herauszubewegen. Eine Selbstverachtung, die daher rührt, dass ihm Zeit seines Lebens nicht die Möglichkeit gegeben wurde, Gefühle zu zeigen. Wie man sich umarmt, musste er regelrecht erlernen. Seiner Freundin zu sagen, dass er sie liebt, scheint nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit. Der streberische Eigenbrötler lebt in einer anderen Welt.
Einer Welt, in der Emotionen anders ausgedrückt werden. Zum Beispiel in der Stille, die sich ausbreitet, wenn ein neuer Kletter-Triumph abgeleistet wurde. Free Solo von Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi, der im Rahmen der Oscarverleihung 2019 als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde, gelingt dabei etwas, woran viele andere Dokumentationen gerne scheitern: Er ist sowohl überwältigendes Seherlebnis und gleichzeitig vielschichtiges Psychogramm. Das Ziel, den beinahe tausend Meter in die Höhe reichenden El Capitan im Yosemite-Nationalpark zu besteigen, die Mutter aller Free-Solo-Felsen, unterliegt hier nicht nur der Herausforderung eines rein sportlichen Gedankens, sondern auch dem Zwang eines Mannes, der sich selbst von seiner emotionalen Legasthenie heilen möchte. Dass Alex überhaupt eine Freundin hat, ist erstaunlich. Dass diese es mit dem Extremsportler aushält, fast noch beeindruckender.
Von Verpflichtungen hält Alex nämlich nicht viel, weil diese seiner Lebensmaxime widerstreben. Der Sinn seines Daseins liegt für ihn im Erbringen reiner Leistung. Dem Erreichen von Großartigem. Und Honnold wird tatsächlich Historisches schaffen, wenn er als erster Kletterer überhaupt schließlich den El Capitan Free Solo besteigt. Seinen existentiellen Grundsatz vergleicht er dabei einmal mit den Statuen der Kriegerkultur: Die hundertprozentige Konzentration auf eine Sache, weil das eigene Leben davon abhängt. In einer Szene fragt ihn seine Freundin, ob sie ein Grund wäre, dass Alex seine Lebenserwartungen maximieren würde. Er verneint. Chin und Vasarhelyi erschaffen mit Free Solo gleichermaßen kinetisches wie aufmerksames Kino. Die Kletter-Sequenzen sind ungemein dynamisch, sie pulsierenden vor Elektrizät und rauben dem Zuschauer den Atem. Die Katastrophe wartet dabei hinter jedem winzigen Kontaktpunkt. Es benötigt nicht mehr als eine falsche Fußstellung oder einen zittrigen Finger.
Dass Free Solo Climber oftmals nicht alt werden, ist ein ständiges Thema: Egal, was passiert, der Tod ist der treuste Begleiter von Alex und seinen Mitstreitern. Deswegen sind die formidablen Kameraaufnahmen, die so unmittelbar wie möglich an Alex kleben, um im nächsten Monat einen sagenhaften Panoramablick der Natur einzufangen, nicht nur majestätisch-paralysierend, sondern auch genauso unheimlich wie bedrohlich. Es bleibt aber der umsichtige Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt seines schwierigen Protagonisten, der Free Solo eben nicht zur glorifizierenden Ode auf die Grenzüberschreitung erklärt, sondern die Dokumentation zur differenzierten Studie über innere Besessenheit und seelische Verletzungen erhebt, denen jeder Mensch auf seine Weise ausgeliefert ist. Alex hat einen Weg gefunden, sich seinen Dämonen zu stellen. Einen fraglos extremen Weg, aber es ist sein Weg. Fluch und Segen zugleich.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org











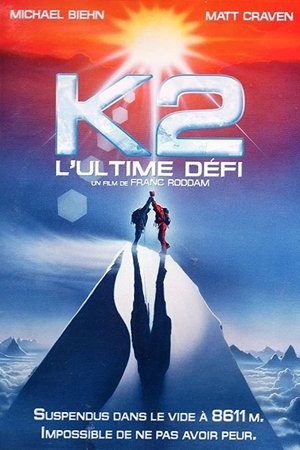
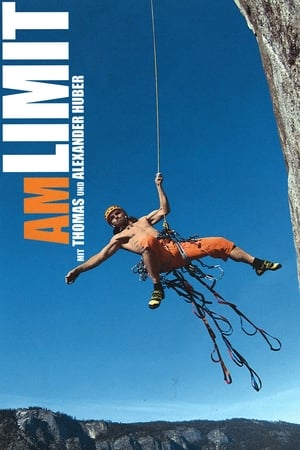

Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!