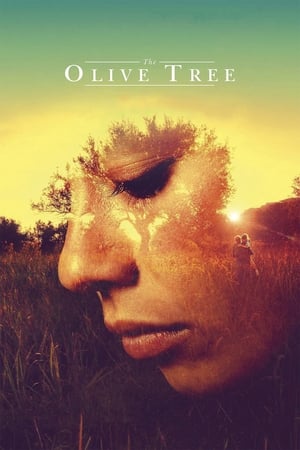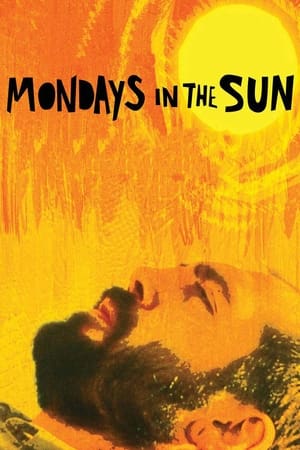Für Alma (Anna Castillo) war ihr Großvater (Manuel Cucala) immer ihr Held. Derjenige, der sie mitgenommen hat in den Olivenhain der Familie und mit ihr zwischen den Wurzeln eines mächtigen Baums spielte, der an die zweitausend Jahre alt sein soll. Bis seine Kinder ‒ Almas Vater und ihr Onkel ‒ darauf beharrten, eben diesen Olivenbaum für eine stolze Summe an ein Unternehmen zu verkaufen, das alte Bäume als Prestigeobjekte in alle Welt verkauft.
Seither spricht Almas Großvater kein Wort mehr und scheint sich dem Leben zunehmend zu verweigern. Auch seiner Familie hat der Verkauf des Baums kein Glück gebracht: Das gemeinsame Restaurant wird längst nicht mehr bewirtschaftet, Almas Onkel Alcachofa (»Artischocke«, ) steht vor den Scherben seiner Ehe, und Alma selbst ist eine rebellische junge Frau mit Bindungsängsten, die auf einer Hühnerfarm die toten Tiere aussortiert. Als sich der Zustand ihres Großvaters weiter verschlechtert, begehrt Alma auf und schmiedet einen tollkühnen Plan: Sie will ihm den alten Olivenbaum zurückbringen.
Der aber steht mittlerweile im Foyer eines Düsseldorfer Energiekonzerns, der nicht vorhat, den Baum zurückzugeben. Weil Alma für ihre waghalsige Mission dennoch Verbündete braucht, tischt sie kurzerhand ihrem Onkel Alca (Javier Gutiérrez, La isla mínima) und ihrem Kollegen Rafa (Pep Ambròs) eine abenteuerliche Lügengeschichte auf. Bald darauf ist das ungleiche Trio mit einem nicht ganz legal geliehenen LKW und einer gestohlenen Freiheitsstatue auf dem Weg gen Norden. Und nur Alma weiß, dass es eigentlich keinen Plan gibt.
El Olivo ist eine geradlinige kleine Geschichte, die genau weiß, wo ihre Stärken liegen: im Zauber ihrer tragikomischen Grundidee, dem liebevoll eingewobenen Humor und dem Charme ihrer teils schrulligen Protagonisten, wobei besonders Alma die Handlung trägt. Ihre Darstellerin Anna Castillo – jung und vor allem als Theaterschauspielerin erfahren – haucht dem furchtlosen Trotzkopf überzeugend Leben ein. Nicht immer ist Alma durchweg sympathisch, ihre Impulsivität auch nicht immer rundum nachvollziehbar, doch ihre Entschlossenheit und ihr kurioser Einfallsreichtum machen da einiges wieder wett.
Auch wenn ihre Begleiter es nicht ganz leicht haben, daneben zu bestehen, zeugt das von Paul Laverty geschriebene Drehbuch doch von der Kunst, mit wenigen hingeworfenen Pinselstrichen charakterliche Tiefe zu skizzieren und glaubhaft zu machen. Während Alcachofas Beispiel hierfür doch einige klare Worte und Screentime bekommt, funktioniert die komplizierte Beziehung zwischen Alma und dem in sich ruhenden Rafa vor allem über das Ungesagte und knappe Dialogzeilen, über Erinnerungen, von denen der Zuschauer nur erfährt, dass es sie geben muss, und kleine, beiläufige Gesten.
Und auch andere Dinge laufen in El Olivo nahezu zwischen den Zeilen ab. Paul Laverty und Regisseurin Iciar Bollaín haben schon für Und dann der Regen zusammengearbeitet, ein Film, in dem der gewaltsame Wasserkonflikt in Bolivien eine zentrale Rolle spielt. In El Olivo sind aktuelle politische Entwicklungen ebenfalls präsent, aber viel impliziter: Alma und ihre Familie sind Opfer der spanischen Krise und der geplatzten Immobilienblase. Der Erlös aus dem Baumverkauf, so erfährt Alma irgendwann im Film, floss als Schmiergeld, um den Bau des Familienrestaurants zu ermöglichen. Letztlich aber bleibt das konkrete Szenario der spanischen Gegenwart reine Kulisse, vor der Bollaín und Laverty eine universelle Geschichte erzählen: Generationenkonflikte, die Suche nach Werten, der Mut, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen – und die Frage, wann man die Vergangenheit loslassen sollte, damit alte Wunden heilen können.
Der zweitausend Jahre alte Olivenbaum – im Film kommt das minutiös nachgebaute Modell eines realen Vorbilds zum Einsatz – fungiert als machtvolle Metapher von Entwurzelung und überdauernden Werten, und er hilft, die enge Beziehung zwischen Alma und ihrem Großvater zu illustrieren. Dessen Darsteller Manuel Cucala ist übrigens kein Schauspieler, sondern von lebenslanger Feldarbeit gezeichneter Dorfbewohner – wie auch der Handel mit alten Olivenbäumen tatsächlich stattfindet.
Auch in seinem ruhigen Erzählfluss weiß El Olivo bis zuletzt die Neugier auf den Ausgang der warmherzigen Quest aufrechtzuerhalten. Obwohl der Film immer wieder mit humorvollen Momenten punktet, wird es nie klamaukig, und auch die charmante Absurdität sprengt niemals ihre Grenzen. Bei allem Idealismus seiner Heldin, bei aller Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist El Olivo dennoch kein reines Feelgood-Movie, was sich vor allem in der letzten Viertelstunde offenbart. Kurzzeitig mag sich der Eindruck einschleichen, dass der Handlungsstrang um Almas Unterstützer in Düsseldorf – die ihre Reise per Skype und Facebook verfolgen – etwas ins Nichts mündet. Doch in Anbetracht der Geschichte, die der Film tatsächlich erzählen will, erweist sich letztlich alles als stimmig und mit dem richtigen Feingefühl komponiert. Wie der schlichte, verspielte Soundtrack von Pascal Gaigne, der ein wenig an Yann Tiersen erinnert. Und weil El Olivo es weitgehend schafft, Klischees zu umschiffen und Kitsch zu vermeiden, kann es gegen Ende nicht schaden, auch ein paar Taschentücher bereitzuhalten.
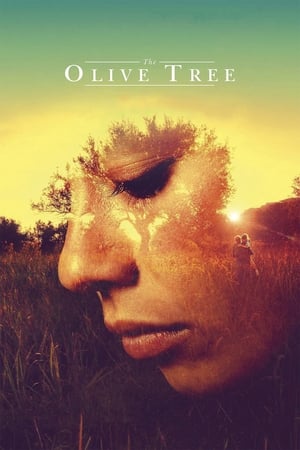 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org