-„Ich finde, alle siegreichen Generäle sollten auch plündern und ein Vermögen anhäufen dürfen!“
-„Selbstverständlich. Und es ist wirklich traurig, dass seine Erben, wie Sie, nicht an seiner Herrlichkeit teilhaben können.“
Endlich spricht es jemand mal aus. Es sollte viel öfter eine Lobby für arme Diktatoren-Kinder geben, die nach jahrzehntelangem Leben in Saus und Braus auf den Gräbern des unwichtigen Pöbels nun praktisch vor dem Nichts stehen, nur weil ihnen der silberne Löffel aus dem Arsch gezogen wurde, wenn aufgrund ganz anderer Ermittlungen plötzlich aktenkundig wird, wieviel ihres Blutgeldes seit Ewigkeiten in den USA reingewaschen wird. Vornehmlich deswegen kommen sie jetzt aus ihren Löchern gekrabbelt, denn der silberne Familien-Arsch-Löffel könnte eventuell endlich abgegeben werden. Dabei ist Familienoberhaupt Augusto Pinochet (Jaime Vadell, No!) schon seit Jahren – auch faktisch – mehr tot als lebendig. Offiziell ist er schon vor einigen Jahren, an dem Geburtstag seiner treusorgenden Ehefrau Lucia (Gloria Münchmeyer, Der unsichtbare Aufstand), an einem Herzinfarkt verstorben. Tatsächlich ist Augusto Pinochet, der 1973 durch einen (von den USA unterstützten) Militärputsch Chile in eine fast 20jährige Tyrannei stürzte, nur untergetaucht. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn eigentlich wurde er 1776 als Claude Pinoche vor den Türen eines Pariser Waisenhauses abgelegt, wurde zum General unter Louis XVI. und verschwand nach der französischen Revolution unter dem Radar (mit dem Kopf von Marie-Antoinette im Gepäck), nur damit sich die Geschichte zweihundert Jahre später aus anderer Perspektive wiederholen sollte. Wie kann das sein? Nun, Pinochet ist ein Vampir.
Ein Vampir, der das Blutsaugen aufgegeben hat, nachdem sein Schreckensregime in sich zusammenfiel und er sich (wie immer viel zu spät) mit einer lebenslangen Haftstrafe konfrontiert sah. Also wählte er nach 250 Jahren den Hungertod, doch aus irgendeinem Grund gibt der trockene Blutsauger einfach nicht den Geist auf. Nun ist sogar die bucklige Verwandtschaft in Form seiner fünf Kinder angereist, die endlich die Chance auf das vermeidlich stattliche Erbe wittern. Aber auch wenn sie selbst keine Untoten sind, wissen sie schon, dass es etwas mehr braucht als den Lauf der Natur, damit der greise Goldesel endlich die Geldschatulle öffnet. Als cleverer Move wird Carmencita (Paula Luchsinger, Ema – Sie spielt mit dem Feuer) als angebliche Buchhalterin hinzugezogen. In Wahrheit soll sie im Namen Gottes dem störend widerspenstigen Patriarchen endgültig den Garaus machen. Doch es kommt alles ganz anders: ausgerechnet durch sie entwickelt der lebensmüde Untote wieder neunen Lebenswillen. Und begibt sich wieder auf die Jagd nach frischem Blut. Da kann nur noch Mutti einschreiten, bevor alles endgültig den Bach runtergeht.
Darf man das? Da wird ein realer Massenmörder wie Augusto Pinochet - auf dessen Befehl zigtausend Menschen verschleppt, gefoltert und hingerichtet wurden – als Protagonist, manchmal sogar fast Sympathieträger, eines völlig absurd anmutenden Filmexperiments benutzt. Das kann schnell als pietätlos ausgelegt werden, aber es kommt – wie immer – auf den erkennbaren Kontext an. Und wenn es für eine bescheuerte Hitler-Sketchshow wie Jojo Rabbit problemlos einen Oscar gibt, dann ist jedes fragwürdige Wort über so eine wirklich mutige Melange schier lächerlich. Die Vita von Pablo Larraín ist praktisch gezeichnet von sehr eigenwilligen, nicht unbedingt detailgetreuen, sondern mehr individuell ausgelegten Biopics. Sowohl No!, Jackie als auch Spencer legten nicht unbedingt Wert auf absolut verbriefte Korrektheit, sondern sollten mehr ein Schicksal aufgrund eines emotional selbstinterpretierten, überspitzen Zustands greifbar(er) machen. Das machte seine bisherigen Werke schon kontrovers bis sogar angreifbar und wer damit ein Problem hatte, der dürfte bei El Conde ungesehen kopfüber aus dem Fenster springen. Es dürfte denjenigen viel Leid ersparen.
Möge man sein bisheriges Schaffen in diesem Bereich noch großzügig als „eigene Interpretation“ auslegen, ist das hier – mit Ansage – ein biestiger Frontalangriff. Wie oft musste (zurecht) über die Qualität von Netflix-Filmen geschimpft werden, die viel Geld für wenig Qualität generieren und so nur das einstige DTV-Regal in der Videothek ersetzten. El Conde zeigt die (leider) zu seltene Kehrseite der Medaille. Denn Streamingdienste wie das rote N bieten auch Möglichkeiten. So ein Film wäre niemals so großflächig vermarktet worden und würde vermutlich gar nicht existieren, ohne das Geld des Streaming-Riesen, der einigen kreativen Köpfen noch freie Hand erlaubt. Ähnlich wie bei Martin Scorsese und The Irishman. Für das Kino so auf dem Papier nicht lukrativ genug, aber die hohen Budgets werden nicht mehr nur auf der großen Leinwand gezogen. Eher hier. Und da sitzt auf der Jagd nach Content und Namen das Geld auch mal lockerer. So was ist das perfekte Positivbeispiel.
Da gewinnt ein Netflix häufiger als es verliert und die wahren Gewinner sind in diesem Fall die Endverbraucher. Diese bekommen eine wagemutige Konstruktion aus giftiger, trotz aller Skurrilität durchaus ernstzunehmender Politsatire, schrulliger Horror-Groteske und überdrehter Telenovela-Parabel, die in all dem Irrsinn nicht seine Bissigkeit aus den Augen verliert. Hier bekommt jeder sein Fett weg und das auf teilweise brillante Art und Weise. Der pointierte Witz kann durchaus im Hals stecken bleiben, denn das Grauen der Pinochet-Diktatur und die jahrelange Folgenlosigkeit wird keinesfalls verharmlost. Eher so beiläufig und selbstverständlich in den eigenen Kontext eingewoben, dass es schier erstaunlich ist, wie präzise und treffsicher Pablo Larraín so eine anspruchsvolle und gleichzeitig rotzfreche Mamut- Aufgabe bewältigt. Als gäbe es nichts Einfacheres auf der Welt.
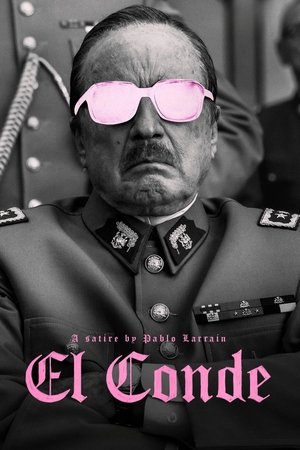 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
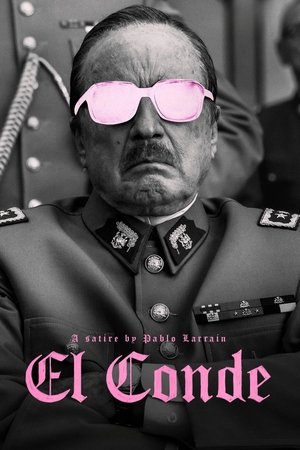











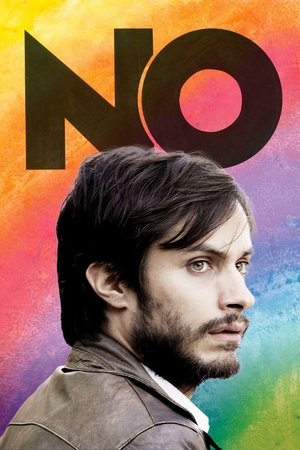


Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!