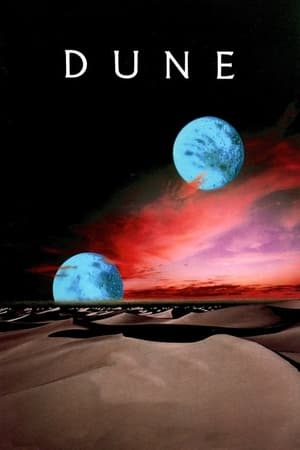Kein anderer Film der Biennale 2021 sorgte auch nur für eine vergleichbare Ballung von Aufmerksamkeit wie Denis Villeneuves (Prisoners) Dune. Trotz des Umstandes, dass die Science-Fiction-Adaption des wirkmächtigen Frank-Herbert-Romans schon weniger als zwei Wochen nach der Weltpremiere in vielen Ländern dieser Welt regulär anläuft, herrschte während der ersten Vorstellungen auf dem Lido di Venezia eine ganz besondere Atmosphäre, die sich nicht zuletzt auch durch die unwahrscheinliche Vorgeschichte aufgeladen haben dürfte, an deren Ende es für Villeneuve und das Kino schließlich doch noch das Happy End einer Kino-Auswertung gab, nachdem es eine ganze Weile noch danach aussah, als würde es als Premium-Content auf dem noch frischen HBO Max abgeladen, das im Mai 2020 an den Start gegangen war. Doch mit Dune ist es ohnehin wie mit einer unendlichen Geschichte, bei sich immer noch ein weiterer Umstand berücksichten lässt. Den Anfangspunkt bildet sicher Herberts Roman aus dem Jahr 1965, dem der Amerikaner noch fünf weitere Sequels hinzufügte, ehe die inzwischen zum Franchise gewordene Reihe von Sohn Brian und Co-Autor Kevin J. Anderson noch um etliche Prequels erweitert wurde. Dazu haben sich mit Alejandro Jodorowsky sowie David Lynch bereits zwei bedeutende Filmemacher daran gemacht, Herberts Werk eine filmische Entsprechung gegenüberzustellen und scheiterten auf ihre ganz eigene Weise daran. Wie also sich einem solchen Mammut-Projekt annähern?
Es erscheint auf gleiche Weise vorausschauend wie riskant, das Franchise in die Hände Denis Villeneuves gegeben zu haben. Einerseits dürfte neben Christopher Nolan derzeit kaum ein*e andere*r Filmemacher*in so nah an der Schnittstelle von Unterhaltungs- und Autor*innenkino arbeiten wie der gebürtige Kanadier, der sich nach den Achtungserfolgen Prisoners, Enemy und Sicario offenbar bewusst für die Hinwendung zum Science-Fiction-Genre entschieden hat, das, wie ein erstes Herantasten, mit dem über Weite Strecken doch reduzierten Arrival seinen Lauf nahm und sich, nach dem bei der Kritik wie am Box Office erfolgreichen Drama über die Diffizilität des Erstkontakts mit einer außerirdischen Spezies, in der Verantwortlichkeit über die Fortsetzung des Kultklassikers Blade Runner mündete. Andererseits war es aber eben diese Fortsetzung, die trotz des kritischen Zuspruchs am Box Office ein Verlustgeschäft bedeutete und erstmals die Frage aufwarf, ob man Villeneuve Projekte dieses Kalibers anvertrauen könne. Die Antwort, das lässt sich mit Blick auf das Dune-Projekt ganz gewiss sagen, lautete „Ja“, und es wird sich erst nach den Einspielergebnissen auf dem sich noch immer nicht gänzlich von der Pandemie erholten nordamerikanischen Markt zeigen, ob Villeneuve das gelingt, woran Christopher Nolan, sicherlich auch pandemiebedingt, mit Tenet gescheitert ist. Wie verhält es sich nun also mit Dune 2021? Als Part 1 bezeichnet handelt es sich hier tatsächlich nur um die erste Hälfte des ersten Teils der Roman-Reihe, und man mag wenig Zweifel daran hegen, dass man sich bei Warner Bros. vermutlich auch weiteren Teilen nicht abgeneigt zeigen würde, wenn das High-Concept-Science-Fiction-Spektakel nur genügend einspielt.
Die Bedingungen hätten indes kaum besser sein können. Die technische Umsetzung ist brilliant, Villeneuve, das beweist Dune von der ersten Sekunde an, da uns der Sound auf markerschütternde Weise entgegendröhnt, möchte mit jeder Einstellung unter Beweis stellen, dass ihm im Jahr 2021 alle technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die für die früheren Adaptionsversuche noch auf kreative, analoge Weise hatten gelöst werden müssen. Hinzu kommt ein Star-Ensemble, das seines gleichen sucht, angefangen bei Timothée Chalamet (Call Me By Yor Name), dessen vornehme Blässe ebenso wie das dunkle, gelockte Haar und die charakteristischen Wangenknochen exakt dem entsprechen dürften, was man sich unter einem jungen Aristokraten vorstellt, auf dessen schmalen Schultern sich schon bald die Hoffnungen des Universums verlagen sollen.
Paul Atreides, so heißt der Sohn des Dukes Leto (Oscar Isaac, Inside Llewyn Davis), der vom Emperor, der mächtigsten Gestalt des Universums, damit beauftragt wird, Kontrolle über den Planet Arrakis zu übernehmen, ein Wüstenplanet, der gemeinhin auch als Dune bezeichnet wird und der über die wertvollste Resource des Universums verfügt, das psychoaktive Chemikal, das alle nur Spice nennen. Jenes sichert nicht nur das andernfalls lebensgefährliche interstellare Reisen, sondern verbessert auch die Lebensqualität derer, die es zu sich nehmen. Insbesondere die Bene Gesserit, eine mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Schwesternschaft, der Pauls Mutter Jessica (Rebecca Ferguson, Mission: Impossible – Fallout) angehört, verdanken ihre Fähigkeiten der Materie, die die Augen der Bewohner Dunes durch ihren häufigen Kontakt saphirblau färben. Doch das Unternehmen des Hauses Atreides, ein Bündnis mit den indigenen Fremen zu bilden, die Duke Leto und sein Haus nur als weitere Nachfolger ihrer bisherigen Ausbeuter ansehen, die Lehnsherren des Hauses Harkonnen, droht zu einem Hinterhalt zu geraten.
Ein Epos in der Ödnis, oder die Ödnis im Drama?
Es mag unfair erscheinen, Villeneuves Film den Vorwurf zu machen, gewissen Handlungstropen aufgesessen zu sein, leiten diese sich doch vom für viele heutige Vertreter des Science-Fiction-Genres grundlegenden Werk Frank Herberts ab, was zur paradoxen Folge hat, dass wir womöglich besser vertraut sind mit all jenen Werken, die Inspiration aus Dune zogen und dies noch immer tun, als mit Herberts Stoff selbst; ein Phänomen, das allen vertraut sein dürfte, die einmal die Muße aufgebracht haben, den Don Quichote aufzuschlagen. Doch ist eine Adaption eben nicht nur eine Bebilderung einer Geschichte, zumindest, wenn sie auch gut sein will. Mit Dune hingegen, und es erscheint beinahe grotesk, solche Worte bei diesem unermesslichen Aufwand zu gebrauchen, der betrieben wird, um weniger diese Welt als dieses Universum zum Leben zu erwecken, spielt Villeneuve es safe. „Dreams are messages from the deep“, heißt es da in der Eingangseinblendung, und auf diesem Niveau bleibt es dann auch über die gesamte Laufzeit. Nichts ist wirklich falsch, nichts unpassend, nichts störend. Genauso verhält es sich auch mit unserem Helden Paul, der der Legende eines Auserwählten denkbar nahekommt, diesem Status aber erst noch zu entsprechen lernen muss. Bis es soweit ist, fügt sich der zukünftige Erbe des Hauses Atreides in seiner Passförmigkeit, die höchstens mal für einen Moment angetastet wird, wenn er einem Impuls nachgibt, für den er dann umgehend um Entschuldigung bittet, auf ideale Weise in dieses Universum ein, die gleichzeitig so detailliert und megalomanisch ist, wie sie von allem befreit zu sein scheint, was sie interessant gestalten würde.
Das ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass Villleneuve, bei aller Sorgfalt, die dem World-Building zugewandt wird, ohne interessante Charaktere aufwartet. Sie alle wirken am Reißbrett entworfen, was nicht weiter verwundert, wird doch Dune immer wieder als Reißbrett anderer Geschichten bezeichnet. Die Vorhersehbarkeit wäre indes nicht weiter schlimm; es würde beispielsweise nicht stören zu sehen, wie die Mentor-Figur dieses Filmes eben jenes Schicksal ereilt, welches Mentoren-Figuren solcher Geschichten eben zu ereilen pflegt. Nein, es wäre sicher halb so schlimm, wenn Villeneuve nur die Poesie dieser Geschichte einzufangen wüsste – die Poesie der Bilder, von der er einst in einem Interview behauptete, dass sie es sei, um die es beim Filmemachen mehr als alles andere gehe. Stattdessen arbeitet sich Villeneuve auf 155 Minuten an seinem Plot ab, hastet von einer Station und Situation zur nächsten und erzeugt dabei allen voran eine große Leere, die auch der betont-epische Soundtrack Hans Zimmers (der sich selbst als großen Fan des Romans bezeichnet und dem Autor mit dem Stück "Herbert" auch Tribut zollt) nicht ablenken kann. Positiv lässt sich dafürhalten, dass die kanpp zweieinhalb Stunden niemals langweilig geraten — auch, weil Villeneuve uns gar keine Gelegenheit dazu gibt, uns zu langweilen.
Misstrauisch hingegen sollte man werden, macht man sich nur einmal klar, wie diese Absage an die Langeweile erzeugt wird. Wie ein Ballon wird diese Geschichte aufgeblasen, dehnt sich immer weiter aus, doch da dieser partout nicht zum Platzen zu bringen ist, muss man sich ganz zwangsläufig mit dessen Präsenz auseinandersetzen. Dabei wird es niemals zu kompliziert, die Kompossnadel verliert niemals Norden; Villeneuve erklärt alles auf so klare Weise, dass es sich beinah so anfühlt, als handele man eine Liste des Worldbuilings ab. Es ist vermutlich deswegen, dass sich Dune anfühlt wie ein langer Serienpilot. Und es ist vermutlich die größte Schwäche von Dune 2021, dass er, trotz des aberwitzig dröhnenden Sounds (der Oscar wird ihm nicht zu nehmen sein) und der atemberaubenden technischen Umsetzung filmisch so ideenlos ist.
Einen Meilenstein hatte man sich erhofft von Dune, auf dem Papier sprach alles nach einem Film „for the ages“. Doch ein herausragend designter Film, der uns über zwei Stunden problemlos an den Kinosessel fesselt, fühlt sich schnell an wie falscher Zauber, wie eine Schmonzette, die uns kurz zum Weinen bringt, ein Weinen jedoch, über das wir später lachen, uns ärgern oder uns sogar schämen und an die wir uns bald schon nicht mehr erinnern. In Dune, da lacht man nicht. Da weint man auch nicht. In Dune, da lässt man sich in eine Geschichte hineinziehen, über deren Figuren wir später nicht mehr sagen können als das, was über sie gesagt wird. Im Gedächtnis mag Herberts Roman bleiben, Villeneuves Film wird es jedoch leider nicht. Es ist ein großes Spektakel, das man unbedingt im Kino sehen sollte, wenn auch nur für den falschen Zauber.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org