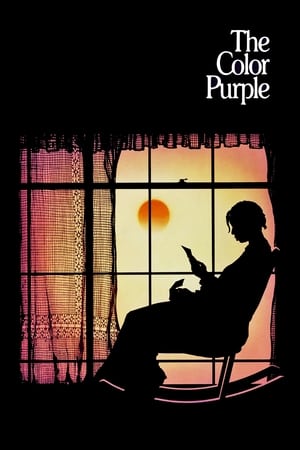Wer mit dem „Fall Hirut“ vertraut ist, der weiß um seine Brisanz und Auswirkungen, die er rechtlich, gesellschaftlich und politisch hatte. Wer von Hirut (Tizita Hagere) zum ersten Mal hört, der wird wahrscheinlich ungläubig den Kopf schütteln. Ja, Hirut droht der Tod, weil sie ihren Entführer und Vergewaltiger erschoss. Die Entführung und Vergewaltigung war im ruralen Äthiopien im Jahre 1996 nämlich eine Tradition, in der Männer sich ihre Braut aussuchten und eben jene Taten begingen. Das ist natürlich etwas, was mit dem reinen Menschenverstand nicht vereinbar ist und aus diesem Film ein sehr politisches Werk macht, das eine klare Stellung zum Inhalt hat und auch mit der gleichen Klarheit die gezeigten Figuren behandelt. Die manipulative Schwarz-Weiß-Malerei wird da vor allem am Anfang sehr großzügig aufgetragen und weicht erst mit der Zeit einigen positiv überraschenden Momenten.
Regisseur Zeresenay Mehari ("Africa Unite") liefert ein Debüt ab, das Anerkennung verdient. Anerkennung dafür, dass er sich einem Stoff annimmt, dessen Thematik man durchaus als Brocken bezeichnen darf. Anders als das Drehbuch, gelingt es Mehari zudem eine passive Ruhe in seine Inszenierung einfließen zu lassen, die stets dokumentarisch dicht an seinen Figuren bleibt und seinen Blick nur von ihnen abwendet, um ein paar Details einzustreuen. Und hier offenbart sich auch die größte Stärke des Filmes, in den Szenen, die besonders ruhig sind und sich abseits des Justiz-Rummels wiederfinden. Da gibt es eine Szene, in der die Anwältin Hiruts Familie besucht und danach zurück in ihr Büro möchte. Hiruts Eltern jedoch bestehen darauf, dass sie noch mit ihnen eine Mahlzeit einnimmt, schließlich sei das Tradition. Tradition ist hier das Stichwort, denn die ist auch dafür verantwortlich, dass Hirut auf ihre Hinrichtung wartet. Ein bitteres Paradoxon.
Ebenso gekonnt nähert Mehari sich der weiblichen Bevölkerung Äthiopiens und den weiblichen (älteren) Figuren des Films. Es herrscht eine generelle Verunsicherung, die die Frauen zu sehr zwiegespaltenen Menschen macht. Natürlich ist nicht fair, dass sie so viel weniger Rechte haben als Männer. Aber die Angst vor der Moderne, der Gleichberechtigung, sie ist da. Die Angst, den neuen Aufgaben nicht gewachsen zu sein, die Angst vor dem Unbekannten eben. Sie ist nicht omnipräsent, aber sie existiert stets leise im Hinterkopf. In solchen subtilen Momenten begeistert der Film. Und die Ruhe, die über die ganze Laufzeit hinweg vorhanden ist, entfaltet ihre Stärke vor allem dann, wenn das Drehbuch wieder einmal mit einem Schnitzer zur Stelle ist. Denn wie sich das für Filme, auf denen Angelina Jolie ("Unbroken") drauf steht gehört, gibt es auch hier jede Menge Daumendrücken, leidende Streichinstrumente, weinende Gesichter im Close-Up und altruistisch-schmalzige Sätze. Aber darüber sieht man gerne hinweg, da man stets wieder mit Pluspunkten belohnt wird.
So richtig schade wird es erst, wenn der Film von Anfang bis Ende nicht daran interessiert ist, seinen Inhalt, seine wichtigen und richtigen Aussagen und Momente in einen größeren Kontext einzubetten. Die Unterdrückung der weiblichen Bevölkerung oder das Bestehen auf alten, aber nicht altbewährten Konzepten sind doch Probleme, die nicht nur auf dem Land in Äthiopien geschehen, sondern beinahe überall. Die Folgen des Geschehens jedoch werden kurz und knapp auf Texttafeln verband, die vor dem Abspann eingeblendet werden. So wirkt der Film manchmal etwas vorschnell produziert, fast schon reflexartig, als wäre der Verlangen nach der Auseinandersetzung der Thematik wichtiger, als das Verlangen nach einem herausragenden Ergebnis. Da muss man sich doch fragen, ob ein solches Thema nicht eine tiefergreifende und „bessere“, weil genauere Behandlung verdient hat. So weiß man direkt, wie der Film enden wird, was erst einmal beliebig klingt, jedoch auch Sinn macht, weil der Film sonst wohl von seiner grundlegenden Aussage abgelenkt hätte.