Mit Die Dämonischen avancierte 1956 bereits die erste Adaption des zwei Jahre zuvor veröffentlichten Romans The Body Snatchers von Jack Finney zu einem wegweisenden Klassiker des Science-Fiction-Kinos. Don Siegel’s (Dirty Harry) subversiver Horrorthriller passte perfekt in sein aktuelles Zeitgeschehen und griff hinter dem Genre-Deckmantel dankend die allgemeine Furcht (und Panikmache) vor dem Kalten Krieg und insbesondere der feindlichen (und vor allem getarnten) Übernahme der Gesellschaft durch ein das Individuum ersetzendes Kollektiv. Einerseits Wasser auf die Mühlen der von der McCarthy-Ära geschürten Ängste, andererseits aber bereits so was wie eine kritische Aufarbeitung mit deren Auswirkungen. 1978 folgte dann mit Die Körperfresser kommen ein Remake unter der Regie von Philip Kaufman (The Wanderers), dem es gelang, den Stoff nicht nur auf moderne Art und Weise zu interpretieren, sondern auch den gesellschaftlichen Kontext an die späten 70er anzupassen und seinem Vorgänger in nichts nachzustehen. Diese dritte Verfilmung aus dem Jahr 1993 musste sich also nicht nur mit einem, sondern gleich zwei waschechten Genre-Klassikern messen und das zu einem Zeitpunkt, als solche Filme gerade nicht die allerhöchste Priorität besaßen.
In den frühen 90ern definierte sich Science-Fiction-Kino eher durch actionlastige Vertreter und um den Horrorfilm war es eh nicht besonders gut bestellt. Viel vertrauen hatte man wohl auch von Seiten Warner Brothers nicht in die Produktion, die zwar im Wettbewerb von Cannes startete (warum auch immer), dafür selbst in den USA nur einen sehr limitierten Kinostart bekam und entsprechend kaum Geld einspielte. Dabei hatte der Film mit 13 Millionen $ ein für damalige Verhältnisse solides Budget für eine Genre-Produktion dieser Art und auch ein paar halbwegs prominente Namen parat. Besonders ungewöhnlich gestaltet sich die Wahl des Regisseurs. Für Independent-Filmer Abel Ferrara – bekannt geworden durch unkonventionelle, harte und teils sperrige Kost wie The Driller-Killer, Die Frau mit der 45er Magnum, King of New York oder Bad Lieutenant – war dies sein erster und bis heutige einzige Ausflug in die Welt des „Popcorn-Kinos“. Eine reine Auftragsarbeit, wie man sie sonst von ihm nicht kennt. Für das Script zeichnete sich u.a. (beteiligt waren insgesamt 5 Autoren, in der Regel kein so gutes Zeichen) Stuart Gordon mitverantwortlich, der durch Werke wie Der Re-Animator sicherlich als Fachmann für außergewöhnlich „körperlichen“ Horror bezeichnet werden darf.
Das Geschehen wird aus der Stadt verlagert auf einen Militärstützpunkt, sozusagen einen gesellschaftlichen Mikrokosmus für sich, an dem naturgemäß schon etwas andere Regeln und striktere, konsequenter umgesetzte Hierarchien herrschen als anderorts. Ein für die Handlung nicht ganz unwesentlicher und an und für sich interessanter Schachzug, mit dem gleichzeitig auch Produktionskosten gespart werden konnten. Zwar war dadurch etwas mehr militärisches Equipment erforderlich, gleichzeitig aber blieben die Sets überschaubar und auch etwaige Probleme mit Drehgenehmigungen fielen weg. Alles spielt sich in einem recht engen Radius ab, was Fluch und Segen zugleich ist. Einerseits bleibt das Setting beengter und versprüht ein zusätzliches Gefühl von Ausgeliefertsein und Ausweglosigkeit, andererseits neigt es ab einem gewissen Punkt auch zur leichten Monotonie und nimmt der Gesamthandlung etwas die Größe der Bedrohung, auch wenn man am Schluss bemüht ist, diese wieder herzustellen.
Der Weg dorthin zeichnet sich als typischer B-Horror, der aufgrund der beinah unvermeidlichen Kenntnis einer der Vorlagen sicherlich nicht allzu überraschend daherkommt, sich dieser Situation aber wohl auch bewusst scheint. Schnell dringt man zum eigentlichen Kern der Handlung vor und spart sich ausschweifende Erklärungen, was dem Tempo natürlich zugutekommt. Aber auch dieser Punkt hat auch seine Schattenseiten, denn mit seinen knapp 87 Minuten Laufzeit wirkt der Film spätestens in der zweiten Hälfte etwas gehetzt, eventuell im Nachhinein auch noch nachträglich gestrafft. Dazu gibt es keine Belege, aber es fühlt sich stellenweise so an. Dies könnte erklären, warum z.B. mit der von Forest Whitaker (Black Panther) gespielten Figur des Militärpsychologen beinah fahrlässig umgegangen wird. Dieser taucht nur in zwei Szenen auf und hätte – allein durch seine Position auf dem Stützpunkt, wie angedeutet in seiner ersten Szene – von hoher Bedeutung für den Plot sein können, wenn nicht sogar müssen. Das ist ziemlich unverständlich und eindeutig eine vertane Chance, ob äußere Umstände dafür verantwortlich sind, lässt sich allerdings nur mutmaßen.
So wirkt Body Snatchers – Die Körperfresser insgesamt deutlich kleiner – oder besser kleingehaltener – als er eigentlich müsste, denn die Grundthematik ist nach wie vor hochveranlagt und wenn man ihn als reines B-Movie betrachtet, kann er speziell in Einzelmomenten auch voll überzeugen. Insbesondere die handgemachten Effekte (die dem Film einst in Deutschland eine inzwischen aufgehobenen FSK:18- Einstufung bescherten) sehen hervorragend aus und sind der Thematik angemessen schön schleimig, creapy und explizit. Zudem beweist der dem massentauglichen Unterhaltungs-Kino eigentlich komplett fremde Abel Ferrara, dass er auch diese Mechaniken erstaunlich souverän beherrscht. In einigen Situationen gelingt es ihm sogar, die gespenstische Qualität seiner Vorgänger treffend nachzustellen, wobei hier sehr deutlich an die 78er-Version angelehnt (die Reste holt die Müllabfuhr und natürlich der markerschütternde Enttarnungsschrei). Zudem scheut er sich, ähnlich wie dort, nicht vor drastischen Konsequenzen und vor allem einem wenig Hoffnung spendenden Ende, auch wenn dieses wesentlich offener gehaltener wird als noch bei Kaufman (das Original von Siegel war dahingehend noch deutlich zahmer, was wohl der größte Schwachpunkt dieser Version ist). Auch hier beschleicht einen das Gefühl, dass womöglich noch mehr machbar gewesen wäre, nicht zuletzt durch den militärischen Hintergrund, der noch wesentlich mehr Möglichkeiten in allen Belangen darbieten, als schlussendlich Verwendung finden.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org










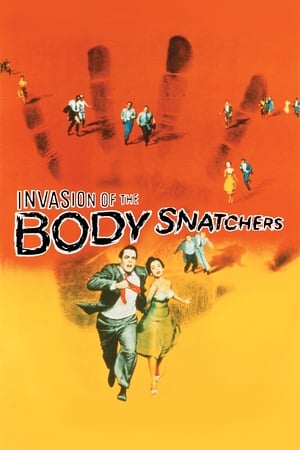
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!