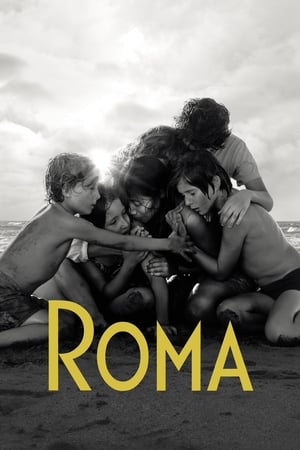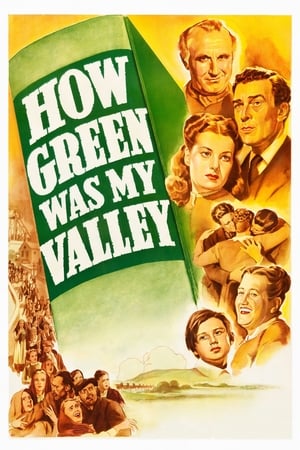Es ist eine von Nostalgie getränkte Zeit, in der wir uns dieser Tage befinden. Das deutsche Fernsehen, beispielsweise, kam im Jahr 2021 nicht umhin, seine einstigen, vermeintlichen Heilsbringer wie Wetten, dass…? oder TV Total wiederzukäuen und deren kulturellen Status durch solcherlei Neuauflagen zu zementieren, während das Unterhaltungskino seinerseits die Fortschreibung in der Evokation des Vergangenen suchte: Marvel warb für seinen neuen Spider-Man mit der Inkorporation dessen früherer Superhelden- und Schurken-Inkarnationen, Lana Wachowski sah sich dazu genötigt, Warner Bros. einen neuen Matrix-Film zu produzieren, einzig, so scheint es, um dem Studio dabei zuvorzukommen, das Projekt an andere Erfüllungsgehilfen zu delegieren (ein Scheinwahl, deren impliziten Zwang Wachowski dann auf halbgare Weise in ihrem Film diskutiert), und auch Steven Spielberg, wenngleich wenig überraschend, fiel im Jahre 2021 nichts Besseres ein, als mit West Side Story einen überkommen geglaubten Stoff wieder aufzugreifen.
Weder sind diese Beobachtungen neu, noch ist es die Kritik an jener Ära der Nostalgie, während derer sich vermutlich mehr als je zuvor an etablierten Marken und deren Vertriebsmöglichkeiten geklammert wird. Doch während die Marktlogik der Studios, die solche vermeintlich sichereren Investitionen bestimmt, einleuchtet, versprach das Kino gleichzeitig immer auch, die Gegenwart als veränderbar zu begreifen, ein Fenster, das uns Zuschauer*innen dazu einlädt, es hin und wieder einen Spalt breit aufzustoßen und unsere Gemüter daraufhin abzuklopfen, was uns verunsichert und bezaubert, uns affiziert und abstößt, uns agitiert und in Resignation versetzt. Und wenngleich ein solches Kino niemals zum Kassenschlager taugte, gab es da doch immer eine Alternative, ein Kino, das, der Vergangenheit abgewandt, sich darum bemühte, der Gegenwart eine Form abzutrotzen und bestenfalls über diese hinaus verweist.
Dieses Kino existiert freilich noch immer, doch hat sich innerhalb der jüngsten Dekaden in dieser (schematisch unterkomplexen) Klassifizierung noch eine dritte Kategorie Kino zwischen die Avantgarde und das Unterhaltungskino geschlichen, das sogenannte Oscar-Kino. Im Gewand eines künstlerisch anspruchsvollen Filmes daherkommend und von den Studios früh als Oscar-Kandidat deklariert, führen diese Filme monatelange Kampagnen, die insbesondere dazu dienen, überhaupt auf dem Radar der Academy-Mitglieder aufzutauchen. Immer wieder erschienen in den letzten Jahren Berichte, in denen angezweifelt wurde, ob auch ausnahmslos alle Stimmberechtigten sich tatsächlich alle relevanten Filme ansehen, die die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in privaten Screenings in Beverly Hills oder auf der hauseigenen, exklusiven Streaming-Plattform zur Verfügung stellt. Und wenngleich es fraglich ist, ob dieses grundsätzliche Problem zukünftig in den Griff zu kriegen sein wird, so ist doch festzuhalten, dass es letztlich nicht Kenneth Branaghs Belfast ist, der unter der Missachtung der Oscar-Stimmberechtigten zu leiden haben wird, schließlich ist Belfast im wahrsten Sinne des Wortes preisverdächtig.
Tatsächlich ist Branaghs autobiographische Rückschau auf eine Episode aus seiner Kindheit in der nordirischen Hafenstadt Belfast genau das, was sich unter dem Begriff Oscar-Film subsumieren lässt: die Betonung der Wichtigkeit der Familie, das Kino als Refugium vor den kleinen und großen Schrecken des Alltags und, vor allem anderen, die Nostalgie, die jede materielle Not außer Acht lässt. Von dieser weiß Branagh ohnehin nicht allzu viel zu erzählen, und so gerät sein mit frühen Lobeshymnen auf dem Telluride-Festival bedachtes Slice-of-Life-Familiendrama auch mehr zu einer vagen Nacherzählung denn zu einem Stück Leben; eine Nacherzählung, die sich mit furchtbarer Schablonenhaftigkeit begnügt, was insbesondere deshalb betrüblich ist, da das 1969er Belfast durchaus alles anbietet, um das Private mit dem Gesellschaftlichen zu verbinden und somit der Gefahr zu entgehen, sich in bloßer Rührseligkeit zu verfangen.
Viel ist Branagh daran gelegen, uns zu vermitteln, warum es dieser Moment seiner Biographie ist, den es ihn vor allen anderen dazu gedrängt hat, auf der Leinwand zu verewigen, und entsprechend einschneidend fühlt sich die erste Szene in Schwarz und Weiß an, als der neunjährige Buddy (gespielt von Newcomer Jude Hill) auf einer der schmalen Straßen seiner Nachbarschaft einer Meute vandalischer Katholiken gewahr wird, die die Fenster der umliegenden Geschäfte der protestantischen Nachbarschaft einschmeißen und Molotow-Cocktails werfen, die unweit von Buddys Füßen explodieren. Ausstaffiert mit einem Holzschwert und einem Schild, die ihm beim Spielen mit den Kindern des Viertels gerade noch wie eine angemessene Verteidigung erschienen sein mögen, steht die Zeit für einen Augenblick still; die Kamera, die wiederholt und zeitlupenartig Buddy und dessen entgeistertes Gesicht umkreist, fängt den Moment ein, da sich dieser Einbruch der Gewalt in Buddy einschreibt und er sich womöglich erstmals dem Gedanken aussetzen muss, dass sein Zuhause nicht jener Ort uneingeschränkter Geborgenheit ist, den er immer in diesem gesehen hatte. Es ist ein starker visueller Einfall, dem jungen Branagh, den wir in Buddy annehmen können, mit ritterlicher Rüstung auszustatten, führt der 2012 zum Ritter geschlagene Branagh doch seit 2012 den Titel „Sir“ im Namen.
Die Kämpfe zwischen den Katholik*innen und Protestant*innen erreichen während dieser Zeit indes eine neue Dimension und der Konflikt, so zeigt es uns Branagh, ist omnipräsent. Der karikaturesk-manische protestantische Pfarrer etwa, verkörpert vom speichelsprühenden Turlough Convery (Saint Maud, Ready Player One), verdammt in seiner Messe den Katholizismus und ruft das Bild einer sich entzweienden Straße hervor, an deren Gabelung ein*e jede*r die Entscheidung treffen müsse, dem guten oder den schlechten (oder gar bösen?) Pfad zu folgen. Auf wunderbar kindliche Weise beobachten wir Buddy später dabei, wie er dieses Bild für bare Münze nimmt und in die Zeichnung einer eben solchen Straße übersetzt, darüber grübelnd, wie sich der richtige Weg finden ließe. Dieser kleine Ausschnitt kindlicher Naivität reiht sich wunderbar ein in jenes Gespräch mit seiner Cousine Vanessa (Nessa Eriksson), da die beiden aus dem Kopf heraus Namen nennen und diese als protestantisch oder katholisch identifizieren, freilich nicht ohne mit Blick auf ihre Bekannten Widersprüche auszumachen zwischen den Namen, die diese tragen und deren Religionszugehörigkeit. Insbesondere aber gehören jene Szenen, in denen Buddy versucht, Kohärenz und Zuversicht in dieser von Widersprüchen überbordenden Welt zu finden, zum emotionalen Kern der Geschichte, da sich Debütant Jude Hill diese Szene oft genug mit dem großen Ciarán Hinds (There Will Be Blood, München) teilen darf, in dem Buddy nicht nur seinen Pop, sondern vor allem einen Mentor findet.
An Hinds‘ Seite findet sich mit Judy Dench (James Bond 007 - Casino Royale) eine Darstellerin ähnliche Gravität, deren Granny es Branagh allerdings nicht vergönnt, ähnlich bedeutsame Momente des Filmes zu tragen. Komplettiert wird das durchaus beachtliche Figurenensemble, das, wie es Branagh in einem Gespräch mit Christopher Nolan (Tenet) eingesteht, vermutlich nur pandemiebedingt auf diese Weise zusammentreffen konnte, durch Buddys zu häufig auf sich allein gestellte Ma und seinen fast dauerabwesenden Pa, die von Caitriona Balfe (Ford v Ferrari, Money Monster) und Jamie Dornan (A Private War, Wild Mountain Thyme) auf durchaus einnehmende Weise verkörpert werden. Allzu häufig misslingt es Branagh allerdings, einen effektiveren Gebrauch seiner Talente vor der Kamera zu machen, zu eindeutig geraten Dialoge, zu wenig kreativer Geist entfaltet sich in den tonal seltsam inkonsistenten Szenen. Nach der ersten Hälfte des Filmes, da wir Buddy dabei begleitet haben, wie er sich in eine in der klasseninternen Rangliste vor ihm positionierte Mitschülerin verliebt, und dies zum Anlass nimmt, sich künftig in der Schule mehr reinzuhängen; da wir Zeug*innen werden, wie sich Buddy auf unbeholfene Weise seiner mit krimineller Energie ausgestatteten Cousine Vanessa anschließt und nach dem mäßig durchdachten Diebstahl in der nachbarschaftlichen Confiserie zur Enttäuschung seiner Komplizin nur eine Packung Turkish Delight vorweisen kann; da nach den jüngsten Straßenkämpfen eine Barrikade aufgestellt wird, deren Ein- und Ausgang durch eine Wache kontrolliert und dokumentiert wird; da wir erfahren, dass es in den Briefen, die Buddys Mutter in der Abwesenheit ihres Mannes erhält, um ernstzunehmende Steuerprobleme geht, die der in unregelmäßigen Abständen auftauchende Vater versucht, mit der Auswanderung seiner Familie zu entkommen, nach all diesen kleineren und größeren Episoden im zehnten Lebensjahr Buddys, da beginnt Branagh nun, den emotionalen Kern seiner Familiengeschichte zu suchen. Die Szenen häufen sich nun, in denen die Eltern aneinandergeraten, auch Großvater Pop erkrankt schwer, und die tumultartigen Straßenkämpfe wollen nicht nachlassen, schlagen sich stattdessen wiederholt in Plünderungen nieder.
Bedauerlicherweise bleibt Belfast weitgehend ein Film der Suche: der Suche nach komplexen Figuren, die mehr als bloße Funktionsträger sind, der Suche nach künstlerischer Vision, die sich nicht darin erschöpft, in Schwarz und Weiß zu filmen, und nicht zuletzt der Suche nach einem Motiv, das im Belfast des Jahres 1969 nicht bloß einen zu bebildernden Hintergrund, sondern einen Anlass erkennt, das Private und das Politische zu verknüpfen. Stattdessen begnügt sich Branagh mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der Familie (eine Entscheidung, die weniger zu kritisieren wäre, würde der Nordire nur mit vielschichtigen Figuren aufwarten). Dass Belfast zu diesem Zeitpunkt die Stadt mit der größten Arbeitslosenquote im gesamten Vereinigten Königreich ist, wäre dem Film kaum zu entnehmen, gäbe es da nicht eine Stimme aus dem Fernsehbericht, die uns darüber in Kenntnis setzt. Man wird nicht umhin kommen, diesen Film mit Alfonso Cuaróns Roma zu vergleichen, doch glänzte der Mexikaner in seinem Tribut an die Nanny seiner Kindheit von der ersten Einstellung an mit künstlerischer Vision, in der das Putzwasser im familiären Innenhof ein Flugzeug am Himmel spiegelte, so muss doch konstatiert werden, dass Branagh ein solcher Formwille gänzlich fremd ist.
Umso bemühter gerät sein Formexperiment in Schwarz und Weiß, dem er nur in jenen Momenten eine bunte Farbenpracht entgegensetzt, da die Familie gemeinsam ins Kino geht. Die Leinwand als Ausflucht, es ist ein Motiv vermutlich fast so alt wie das Medium selbst. Und wenngleich ihm ein künstlerischer Kniff gelingt, als sich beim familiären Kinobesuch Ken Hughes Kult-Musical Chitty Chitty Bang Bang in bunten Farben auf Grannys Brille spiegelt (ein Moment, der den Film zweifelsohne überleben wird), so zerfällt Branaghs Entscheidung für das allgemein Farblose und diese Kontrastierung bei genauerer Überlegung doch in sich zusammen. Denn wenn das Kino der Ort der Möglichkeiten ist, dieser spielerische Freiraum, der über die Grenzen unseres Alltags hinausverweist, dann stellt sich schon die Frage, warum Branagh seinem eigenen Film die Farben entzieht, ganz, als glaube er selbst nicht an das, was er vorgibt.
Die großen Momente, nach denen sich Branagh in Belfast zweifelsohne ausstreckt, können indes nicht diese Magie hervorrufen, die bei der Sichtung Chitty Chitty Bang Bangs Besitz von der Familie ergreift, als sie, als säßen sie in einer Achterbahn, den Kopf vor und zurück, nach links und rechts lehnen. Als die Vaterfigur des gleichzeitig unverschämt gutaussehenden und doch vom Drehbuch alleingelassenen Jamie Dornan seiner Frau eines Abends in der Küche in großer Bedeutungsschwere erklärt, dass sie mit der Erziehung ihrer Söhne, die sie, wie er gesteht, letztlich ganz allein großgezogen habe, Phänomenales erreicht habe, fühlt sich diese Szene an, als gehöre sie zu einem anderen, einen besseren, Film. Ähnlich fühlt es sich an, wenn Judi Dench in ihrer letzten Szene ihrer abfahrenden Familie noch einmal entgegenblickt, und wir ihre vorerst letzten Worte hören, die sie, obgleich für Buddy und die seinen nicht hörbar, dennoch an diese richtet: „Go now. Don’t look back. I love you so“. Und während dieses Moments, da das Gesicht der verlassenen Judi Dench die Leinwand und somit uns vollkommen ausfüllt, da bleiben auch wir zurück, mit der Frage, was dieser Film hätte sein können. Am Ende scheint es dann so, als habe sich Branagh selbst jene Worte zu Herzen genommen, die er seinem Pa in den Mund legt, wann immer dieser auf unbestimmte Zeit von Buddy Abschied nimmt:
„Be good, son. And if you cannot be good, be careful“. Denn letztlich ist Belfast insbesondere das: ein durch und durch harmloser Film, der, in aller Vorsicht, stets darum bemüht ist, nett und konsumierbar zu sein und deren wenige schönen Momente nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Branagh nicht gelingen will, die Farbe aus den verblassten Erinnerungen zu destillieren.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org