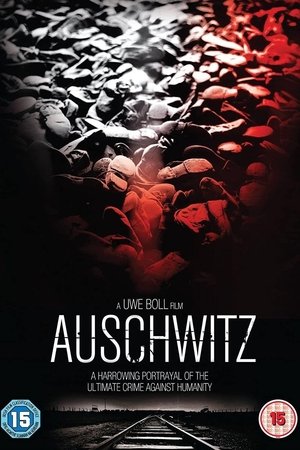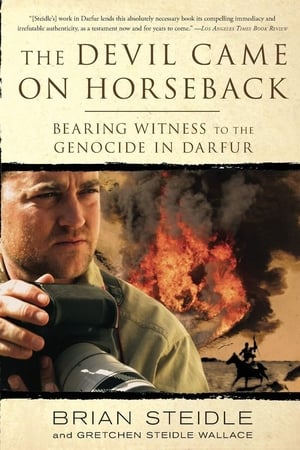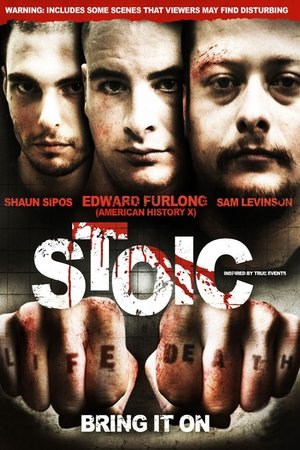Als Kritiker muss man es wohl aus dem Effeff beherrschen, den deutschen Filmemacher Uwe Boll nach Strich und Faden in die Pfanne zu hauen. Die standardisierte Floskel, die in diesen nicht weniger standardisierten Verrissen immer und immer wieder bemüht wird, ist die Bezeichnung Bolls als 'schlechtester Regisseur aller Zeiten', was bedeuten würde, er hätte Edward D. Wood Jr. (Plan 9 From Outer Space) den fragwürdigen, aber durchaus marketingtauglichen Rang abgelaufen. Doch genau wie Ed Wood, der immerhin eine unbändige Liebe zum Medium hat erkennen lassen, hat auch Uwe Boll diesen Titel vermutlich nicht verdient – wenngleich es außer Frage steht, dass der gebürtige Wermelskirchener mit Auschwitz eines der größten filmischen Verbrechen überhaupt begangen hat. Warum man Boll aber nicht abschreiben sollte?
Das lässt sich wohl mit seinem, fast schon manischen, Engagement, die Menschen wachzurütteln, beantworten. Keine Frage, Boll ist kein Filmemacher, der auch nicht den geringsten Sinn für Subtilität besitzt; und handwerklich sind seine Filme selten besser als die Arbeiten einer fortgeschrittenen Video-AG, aber sie versuchen „immerhin“, den Zuschauer mit kritischen Ansätzen zu erreichen und zum Nachdenken anzuregen. Neben seinem Paradethema, dem Kapitalismus, zieht sich parallel ein weiterer roter Faden durch sein Schaffen: Die Natur des Menschen. Und die speist sich, schenkt man Boll Glauben, aus der Quelle des unverdünnten Bösen. Ob man ihm da nun beipflichten möchte oder nicht, sei dahingestellt, für Darfur – Der vergessene Krieg ist dieses tendenziöse Menschenbild jedoch der falsche Schritt.
Und zu Anfang wirkt es auch so, als wäre sich sogar Uwe Boll über diesen Aspekt im Klaren gewesen, wenn er eine Gruppe amerikanischer Journalisten (darunter David O'Hara, Kristinna Loken, Billy Zane, Edward Furlong) im Zuge einer Beobachtermission der afrikanischen Union in das Dorf Nabagaia schickt, um die Lebensgeschichten der hiesigen Bewohner (zum Teil echte Zeugen) aufzuzeichnen. Hier, in seinen besten Momenten, wirkt Darfur – Der vergessene Krieg wie eine empathische Bestandsaufnahme, wie ein Blick hinter die eingeschlagenen Schädel, die zur Hälfte aus dem trockenen Wüstensand ragen, weil der Film tatsächlich den Anschein erweckt, sich für die Geschichte wie auch das Schickal des jeweiligen Menschen, der sie erzählt, zu interessieren. Natürlich belässt es Darfur – Der vergessene Krieg nicht dabei.
Denn wenn sich am Horizont ein Konvoi Dschandschawid aufbäumt und mit erhobener Kalaschnikow auf den Weg zum Dorf macht, bestätigt sich Uwe Boll wieder einmal als agitatorischer Stümper, der sich kein Stück um Zusammenhänge schert. Die arabischen Reiter fallen über den schwarzafrikanischen Stamm her, zerhackte, aufgespießte Babykörper, geschändete, sich vor Schmerzen windende Frauen und bestialische Exekutionen bestimmen von nun an das Bild. Die dilettantische Montage, die den Spuren des Schreckens in Darfur vermutlich eine Patina des Authentischen verpassen sollte, wirkt erneut wie das Werk eines Amateurs, der Hilflosigkeit und Hektik niemals aus der Situation heraus entfachen kann, sondern ausschließlich über die (im doppelten Sinne) billige Effekthascherei.
Uwe Bolls Gefallen an Exploitation spart Darfur – Der vergessene Krieg nicht aus, und Boll, dieser großkotzige Marktschreier, der sich als politischer Filmemacher geriert und tatsächlich glaubt, hier den 'besten Film über Afrika' abgeliefert zu haben, rechtfertigt die sich über 40 Minuten erstreckende Abfolge viehischer Gewaltakte damit, dass sie ja der 'Realität' entsprächen. Dabei vergisst Boll jedoch, dass seine Brutalitäten zu stupiden Trägermedien werden, weil er Schrecken aufzeigt, ihn jedoch zu keiner Zeit kontextualisiert. Sein Grauen ist ein vom Thema entkoppeltes, die Wahrheit indes verbirgt sich dort, wo Boll niemals hingelangen wird: Im Bewusstsein über die mannigfaltigen Deutungsräume vom Medium Film. Darfur – Der vergessene Krieg ist ambitioniert, möchte wachrütteln und schockieren, die Mittel, denen sich Uwe Boll bedient, bleiben jedoch so platt, abstoßend und kalkuliert, dass man sich sicher sein kann: Ja, Boll hat die „Show, don't tell“-Maxime maßgeblich fehlinterpretiert.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org