Kritik
Kino hat insofern immer einen Bildungsauftrag, als dass es uns dazu zwingt, uns mit dem Fremden zu konfrontieren, mit all dem, was ist und sein könnte, sich dabei jedoch unserem Alltagsblick entzieht. Ganz in diesem Sinne präsentiert sich Another Day of Life als visuell hochinteressante Entführung in eine andere Zeit und einen Schauplatz der Stellvertreterkriege, der uns vielleicht gar nicht so geläufig ist: Nach dem Unabhängigkeitskrieg kam es im Jahr 1975 zu einem Entkolonisierungskonflikt zwischen Angola und Portugal, dieser formierte sich jedoch zu einem weiteren Kriegsschauplatz des Ost-West-Konflikts. Dieser Bürgerkrieg, der auch nach Ende des Kalten Kriegs noch bis zur Jahrtausendwende anhielt, gestaltete sich als langwieriger und von außen unübersichtlicher Schauplatz ideologischer und machtpolitischer Interessen.
Als Zuschauer begleiten wir den Journalisten Ryszard Kapuściński, der im idealistischen Überdruss seinen Chef davon überzeugen konnte, ihn nach Angola zu schicken, in eben jenes Kriegsgebiet, in dem sich nach dem Abtreten der Kolonialmacht Portugal, diverse Machtinteressen formatieren. Der Weg, den wir mit ihm gehen und der auf seiner eigenen Biographie basiert, präsentiert sich dabei als spielerische Mischung eines Animationsfilms mit gelungener Cel-Shading-Ästhetik und dokumentarischer Einblendungen, in dem reale Betroffene von ihren Erlebnissen berichten. Diese Gegenüberstellung von größter Künstlichkeit mit surreal anmutenden Teilelementen und maximaler Authentizität ist die Besonderheit und das große Potential des Filmes: Ästhetisch kann er den Zuschauer auf verschiedenen Ebenen begegnen, mit ihnen kommunizieren und Ambivalenzen herauskitzeln. Es hätte ein differenzierter, multiperspektivischer Film werden können.
Doch auch wenn die Optik Derartiges verspricht, kann die Gesamtästhetik dieses Versprechen nicht einlösen: Another Day of Life versucht vorrangig emotional zu ergreifen und entlockt uns damit zwar Betroffenheit, ermöglicht jedoch keine ernsthafte Empathie mit dem eigentlichen Konflikt. Gerade als Uninformierter können die 85 Minuten, die durch die ästhetischen Brüche inkohärent anmuten, kaum Licht ins Dunkle bringen. Stattdessen bleibt die wohl richtige wie banale Aussage: Krieg kostet Leben. Leider verpasst es der Film in diesem Zusammenhang den Konflikt zu politisieren, zu ergründen vor welchem Hintergrund diese Menschen ihr Leben lassen müssen. Das fällt besonders schwer ins Gewicht, weil der Film Stellung im Sinne Kapuścińskis bezieht, indem er durch dessen Wahrnehmung emotionalisiert. So wird der Zuschauer moralisch geleitet, doch fehlt die Kontextualisierung, durch die er eben das erst durchblicken könnte.
Der noble Ansatz des Filmes, einem idealistischen Journalisten ein Denkmal zu schenken, geht währenddessen auf: Nicht nur werden dessen Taten in würdevoller Manier aufgearbeitet, auch bemüht er sich zum Ende hin seiner Tätigkeit einen Wert zu verleihen. Auch wenn diese Ebene kaum ausgeweitet und ein wenig obligatorisch gesetzt wirken mag, ist es dem Film hoch anzurechnen, dass er versucht greifbar zu machen, welcher Sinn - und welcher Selbstzweifel - hinter der journalistischen Tätigkeit steht. In einem solchen Impuls, das Ferne und Fremde greifbar zu machen, steht letztlich auch das ganze Filmprojekt, auch wenn das nicht ganz funktionieren mag. Letztlich bleibt zumindest ein interessanter Versuch, die reine Dokumentation mit der Aufarbeitung in einer neuen Perspektive kulminieren zu lassen.
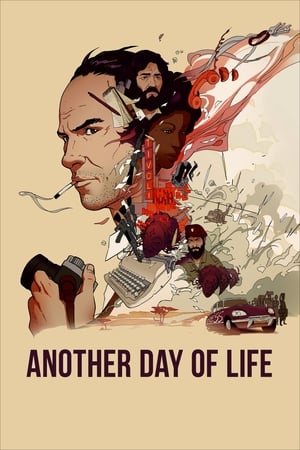 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
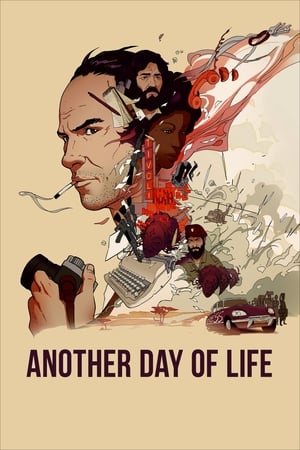




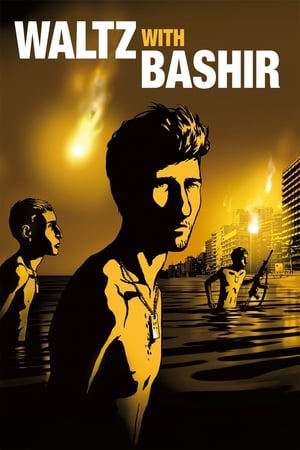

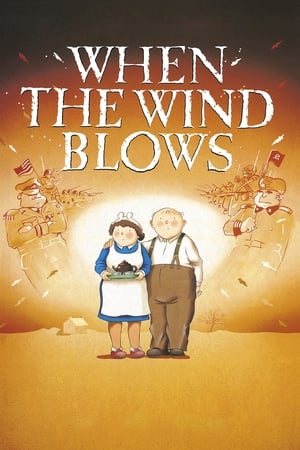
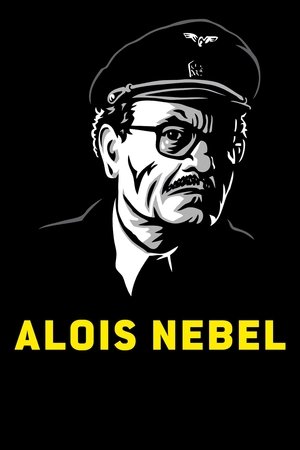
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!