„American Diner“ ist mehr Fingerübung und (treffsichere) Talentschmiede denn ein gelungener Film, dessen Potenzial und Intention nicht verkehrt sind, aber letztlich verschenkt wirkt. Heute ist er fast nur noch den Komplettisten und Nostalgikern ein Begriff, das hat schon seine Gründe.
Ende der 50er Jahre, irgendwo in Baltimore: Das Mitglied einer eingeschworenen Jugendclique tritt in wenigen Tagen vor den Altar, somit kehrt das einzige, abgewanderte Puzzleteil wieder in die Heimat zurück und bemerkt, dass sich dort nicht allzu viel geändert hat. Alle sind noch so wie damals und auch wir als Zuschauer bemerken schnell, wem hier die typische, gruppendynamische Rollenverteilung zusteht. Eddie (Steve Guttenberg, „Police Academy I– Dümmer als die Polizei erlaubt“) droht in den Stand der Ehe zu treten und ist sich noch nicht so ganz sicher, Shrevie (Daniel Stern, „Kevin – Allein zu Haus“) ist dort schon längst angekommen, als einziger so was wie bodenständig und davon nicht besonders begeistert, Boogie (Mickey Rourke, „Angel Heart“) ist der smarte Draufgänger, der an einer eklatanten Spielsucht leidet, Fenwick (Kevin Bacon, „Sleepers“) ein depressiv angehauchtes Sorgenkind, Modell (Paul Reiser, „Aliens – Die Rückkehr“) ist einfach anwesend und Billy (Tim Daly, „Wer ist Mr. Cutty?“) der Zurückgekehrte. So weit, so klar, und das schon nach wenigen Minuten. Dazu kommt noch Beth (Ellen Barkin, „Sea of Love – Melodie des Todes“), die Ehefrau von Shrevie, ähnlich überfordert in der Situation als Frau eine Kindskopfs, der seiner Unbekümmertheit hinterhertrauert. Wie alle im Diner, das als Zufluchtsort ihrer vergänglichen Jugend dient, vor der sie sich fürchten.
„American Diner“ schildert definitiv authentisch die relativ banalen Sorgen der ersten US-Generation, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen ist. Verhältnismäßig problemlos und im behüteten, mittelständigen Wohlstand großgeworden sind sie nun am Scheideweg zwischen rebellischer Unbeschwertheit und dem Erwachsenwerden, den Einfügen in die spießige Langeweile des American Dream seiner Zeit, worauf keiner von ihnen viel Lust hat. Darum dreht sich alles im Kinodebüt von Barry Levinson („Rain Man“), nur weiß er dies trotz seiner bemühten Ansätze nur selten effektiv auf den Punkt zu bringen. Oft dreht sich sein vom Zeitkolorit zweifellos interessanter Film unerfahren im Kreis, findet nur wenige, konkrete Fixpunkte, die mehr in die Tiefe gehen als seine nett gemeinte, insgesamt aber eher oberflächliche Sorgenabhandlung. Klassisches Coming-of-Age gepaart mit Zukunfts- und Existenzängsten mangels der nötigen Orientierung, kalten Füßen vor der Hochzeit, Frust aufgrund einer standesgemäß früh geschlossenen Ehe (eine der besten Szenen: Daniel Stern´s Ausraster wegen der falschen Plattensortierung seiner Frau, inklusive dessen Erklärung dafür), Verschwendung von Talent (Rourke, in Bezug auf seine spätere Karriere fast schon Meta), „drohender“ Vaterschaft und genereller Ziellosigkeit, was alles angerissen, aber kaum konsequent zum Ende gebracht wird.
Die Zielsicherheit beim Talentscouting ist beeindruckend, praktisch jeder Darsteller der wichtigen Charaktere hat (mehr oder weniger) seine Karriere gehabt und unverständlich ist das nicht, denn von Guttenberg (selten besser) über Rourke (unglaublich charismatisch) bis hin zu Reiser (obwohl die uninteressanteste Rolle) kann sich hier jeder profilieren, ein wahres Sprungbrett für das Big-Business. Das kann gelegentlich, nur nicht flächendeckend über die bald fahrlässige Redundanz des Films hinwegblenden, der nur selten aus einem schlaffen Korsett ausbrechen kann und über die gesamte Laufzeit eher mit ermüdenden Gequatsche seine eigentlich schöne Grundlage nicht zu nutzen versteht. Freundschaft, die Vergänglichkeit der Jugend, die Schwelle vom Teenie zum funktionellen Stück einer monotonen, braven Gesellschaft, das behandelt „American Diner“ sichtlich, aber kaum mit Nachhaltigkeit. Bezeichnend dafür, wie belanglos der Film endet, anstatt genau jetzt seinen Höhepunkt zu markieren.
 Trailer
Trailer

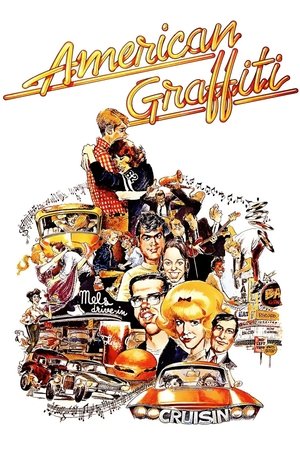



Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!