Quelle: themoviedb.org
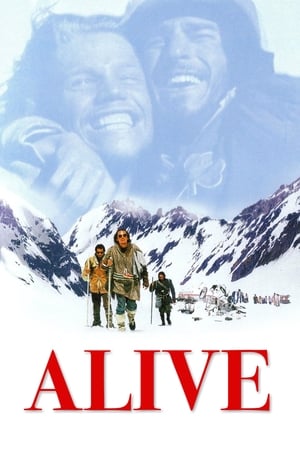 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
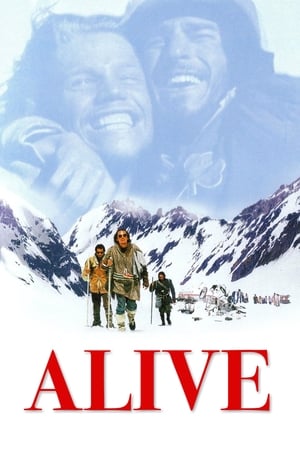
- 130 Min ActionAbenteuerDramaThrillerBiografie USA
- Regie Frank Marshall
- Drehbuch John Patrick ShanleyPiers Paul Read
- Cast Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay, John Newton, David Kriegel, Kevin Breznahan, Sam Behrens, Illeana Douglas, Jack Noseworthy, Christian J. Meoli, Jake Carpenter, Michael DeLorenzo, José Zúñiga, Danny Nucci, David Cubitt
Kritik
Fazit
Kritik: Pascal Reis
Beliebteste Kritiken
-
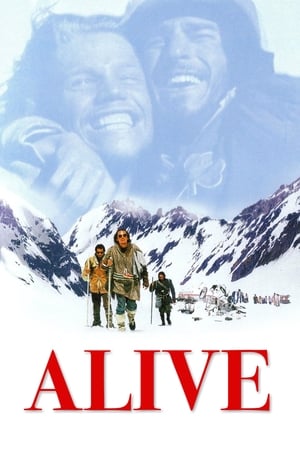
Überleben
Beruht auf wahren Ereignissen: 1972 stürzte ein Rugby-Team aus Uruguay bei einem Flug nach Chile in den Anden ab, woraufhin ein Kampf ums Überleben in der eisigen Kälte beginnt. Der Film ist gut, hätte aber noch etwas intensiver sein können. Positiv ist, dass es mal ein Katastrophenfilm ist, in dem sich die Beteiligten nicht ...
Wird geladen...
×









